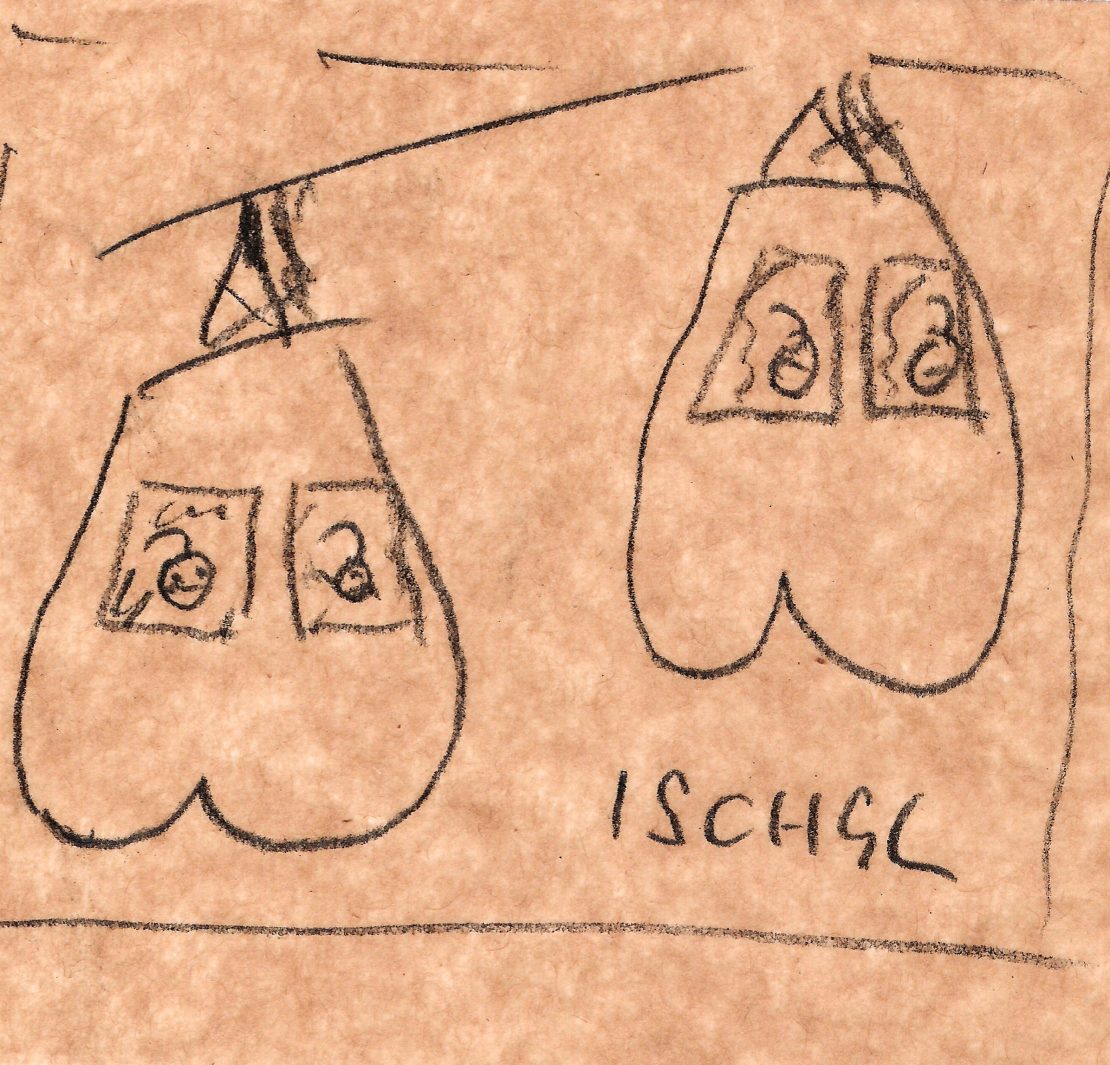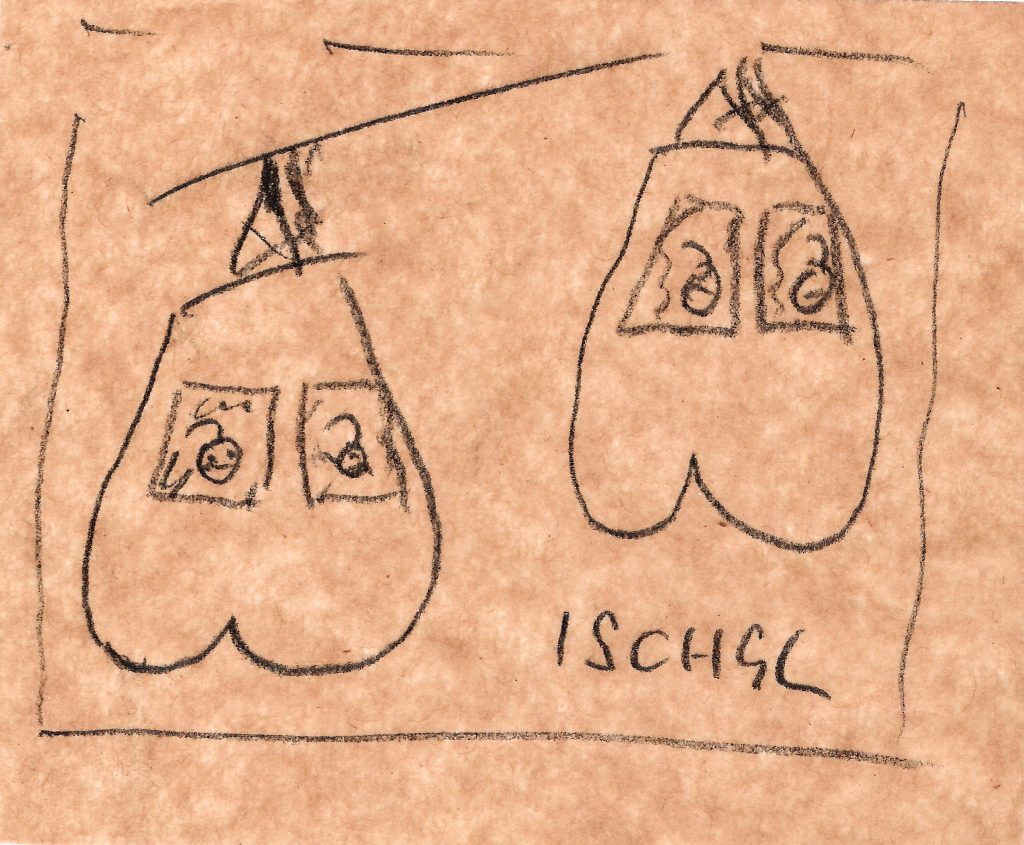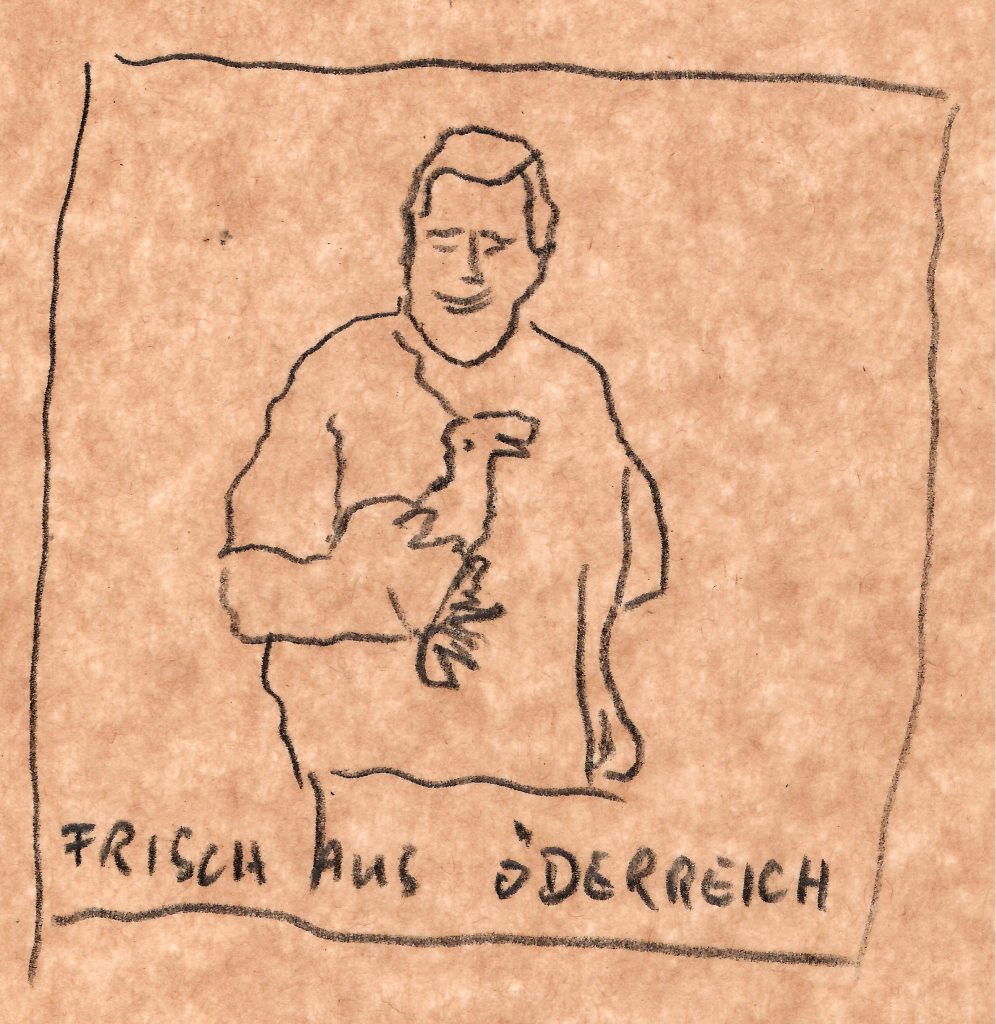Helmuth Schönauer

Hautfarbener 
Hä 
Warum 
Ischgl 
Öderreich
Die Oper auf dem Bierdeckel
In der Konzeptkunst hat der Künstler zuerst Beschreibungen, Strategien, Skizzen und Schlüsselwörter im Kopf, die er zu Papier oder Display bringt. In einem weiteren Schritt können diese Überlegungen vom Urheber selbst oder einem vagen Publikum ausgestaltet werden. Die Entwürfe können aber auch als architektonische „unbuilt“-Modelle in die Archivierung eingehen. (Häufig zitiertes Beispiel ist Raimund Abrahams „(Un)built“, 1996.)
Die ursprünglich auf Malerei und Galeriewesen angewandte Konzeptkunst hat sich längst auf alle Künste ausgebreitet und ist in der Literatur angekommen. Dort unterscheiden wir mittlerweile Literatur, die einer Erzählstrategie folgt, welche ständig in Frage gestellt und neu formuliert wird. Dabei ist es nicht zwingend notwendig, dass ein Gedicht, dessen Struktur formuliert ist, auch quasi mit Beispielwörtern ausgestaltet wird. Manche Lyrikbände bestehen aus bloßer Metaebene, zu der die Leserschaft eine jeweils persönliche Textur enträtseln muss.
Andererseits besteht die Literatur massenhaft aus Beispielwörtern ohne Struktur. Immer noch schreiben tausende Autorinnen jährlich Krimis, deren einziger Sinn darin besteht, regional gefärbte Wörter in einem ewig gleichen Plot unterzubringen.
Viele Autoren verbringen ihr Schaffensleben mit einem einzigen Konzept. Damit es nicht sofort auffällt, wechseln sie ständig die Verlage in der Hoffnung, dass nicht ein Leser aus Versehen mit wechselt und auf ein Buch stößt, das er schon einmal wo anders gelesen hat.
Die Konzeptliteratur setzt sich als Ziel, in jedem angedachten Werk etwas Neues zu erwecken, das vielleicht lange schon im kollektiven Untergrund geschlummert hat. Jedem Kunstwerk wohnt freilich die Fragestellung inne: Warum macht er (der Autor) das, und warum soll ich (die Leserin) das lesen?
Im Zuge der Digitalisierung und Globalisierung stellt sich diese Kernfrage täglich analog und regional. In Tirol beispielsweise gibt es letztlich nichts als Felsen, was man für Kunst verwenden könnte. Das Papier der Alpenbewohner ist das Gestein, ihre Galerie die Höhle. Uns faszinieren diese Höhlenzeichnungen aus der Vorzeit. Wir wissen oft nicht, was es mit diesen Schraffuren auf sich hat, aber wir ahnen, hier wollte jemand ausdrücken, dass es ihn gibt und er etwas gesehen oder gehört hat, das mitzuteilen es sich lohnt.
Die Zeichnung gilt als die menschlichste Form des Ausdrucks, knüpft sie doch an jene Zeit an, als man sich gerade in Höhlen aufgerichtet hat. Der Mensch ist ja deshalb zum Zweibeiner geworden, weil er in Höhlen die Vorderhufe zum Zeichnen verwendet hat.
Literatur hat etwas von diesen Höhlenzeichnungen in die Gegenwart gerettet. Jeder Text folgt einer Archi-Skizze, worin ein wertvoller Augenblick eingefroren ist.
Dieser Augenblick gleicht dem berühmten Bierdeckel, auf dem die entscheidenden Getränke eines Abends abgestellt werden, ehe man sie als Strichliste einer Zeche aus dem Auge verliert.
Der Bierdeckel gilt wegen seiner Überschaubarkeit und Zeitlosigkeit als angestrebtes Ziel höchster Konzentration.
Ein Parteiprogramm, eine Steuererklärung, ja gar eine Verfassung auf einem Bierdeckel gilt als das Immenseste, was sich konzeptuell ausmalen lässt.
Selbst in der wuchtigen Kunstform der Oper träumt man davon, dass alles auf einem Stück Quadrat Platz hat.
Die sogenannten Cartoons auf einem Stück Back-Papier machen diesen Traum möglich. Dabei wird ein großer Augenblick eingefangen und zu einer Vignette verdichtet. Ja sogar eine dramatische Handlungsleiste kann zu einem einzigen Bild verfrieren worin scheinbar zufällig skizzierte Wesen zu einem kalten Augenblick der Analyse werden. Oft ist o einer Szene ein Stück Sprachmaterial beigefügt, wie etwa „Pfui“, „Mama, wo ist der Konsum“. „Ich will Kohle machen“, „Ischgl“ oder einfach nur „Hä?“
Für den Hausgebrauch der pandemischen Hochkultur sind diese Cartoons von unschätzbarem Wert, reagieren sie doch indoor auf externe Gegebenheiten. Zudem ist eine Zeichnung immer wertvoll, es gibt per se keine wertlose Zeichnung, selbst die Null hat als Zeichnung einen Wert.
Text und Zeichen, völlig aus jeweiligen Kontexten gerissen und archaisch miteinander verheiratet, dokumentieren eine gesellschaftliche Instanz, die über dem Individuum steht.
Im Alltagsgebrauch sind diese Opern auf dem Bierdeckel eine ideale Einstimmung für Texte, die über den Umfang eines Displays hinausgehen. Oft genügt dem User, dass er die Zeichnung gesehen hat und er weiß alles. Der anschließende Text ist nur ein Bonustrack für Brave, die in fernen Zeiten noch analog das Lesen gelernt haben.