Stefan Schmitzer liest den Gedichtband Corona von Sophie Reyer
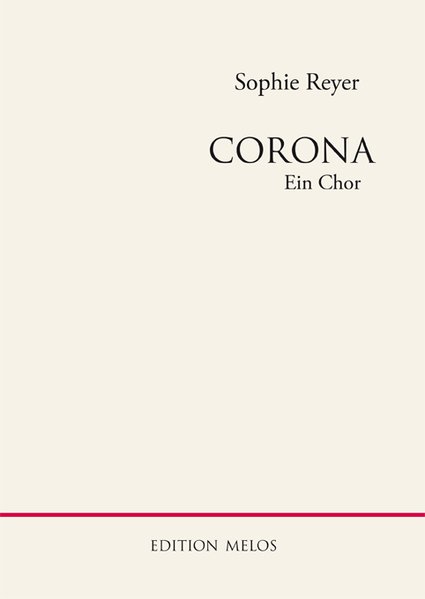
Es mehren sich die Zeichen, dass wir das umfangreiche Werk von Sophie Reyer auch als einen einzigen langen Text lesen können (sollen? dürfen?); oder als ein nichtlinear verästeltes Textgewächs; oder zumindest diejenigen Einträge in ihr Werkverzeichnis, die im weiteren Sinne unter „Gedicht“ laufen (… eine Bestimmung, die bei dieser Autorin bedeutet: alle diejenigen Texte, die von jenem Markenzeichen gewordenen Doppelpunkt in jener ansonsten leeren ersten Zeile eröffnet werden, ganz so, als wollte die Autorin nochmal unterstreichen, wir hörten/läsen da eine direkte Rede oder bekämen die genauere Bestimmung einer Abstraktion vor Augen geführt – und stets bleibe aber notwendigerweise offen, wer es sei, der da so spreche bzw. welche Abstraktion sich gerade so konkretisiere).
Hier zum Beispiel, auf Seite 15 des CORONA. Ein Chor betitelten Gedichtbandes aus 2020, dessen Sprecherinnen-Ich unsere Lebensbedingungen im Lockdown mal näher, mal ferner umkreist … hier haben wir die Wiederkehr jener „Queen of Biomacht“, die schon Reyers Limbus-Band aus 2019 im Namen führte:
© Copyright Edition Melos
: wirst meine Gefahr was willst du mir bieten Queen of Biomacht dünne Lidhaut quellende Augen? (Aber der Mund: Wunde und langsamer Blick: zart werden, darunter. Dennoch: wirst mir Gefahr)
Die Sprecherin sieht das Auge – was zurückschaut, ist der Mund. Erst ihm kommt ein Blick auf die Sprecherin zu. „Gefahr“ geht auf beiden Ebenen von dieser fremdartigen, insektoiden oder zumindest uncanny-vally-mäßig puppenhaften Verkörperung eines hungrigen „Lebens-Selbst“ aus. Dieses Gedicht singt also sexy die Verführung zum Gefressenwerden durch die vorbewusste, oder anders-bewusste Natur, und repräsentiert damit ungefähr die Hälfte der Texte in „CORONA. Ein Chor“ – nämlich diejenigen, welche Momenteindrücke von Lebenszyklen in irgendwelchen Nischen beleuchten und in Relation zum Alltags-Ich setzen (Diese Relation: „Schau, das Leben geht weiter!“). Diese Themen und Motive schreiben sich in Reyers Oeuvre fort und fort und fort, und hier, mit der Wiederaufnahme dieser „Queen“ (es wird nicht das erste Mal überhaupt sein, aber es ist das erste Mal, dass der Rezensent es bemerkt), macht die Autorin diese Fortschreibung explizit.
Die andere ungefähre Hälfte der Gedichte in CORONA. Ein Chor behandeln vor dem Hintergrund solchen Fortwucherns unseren Alltag im teilweisen Lockdown – wie oben gesagt, mal aus der Nähe, mal von fern. Vereinsamung spielt hier eine Rolle, klar; die Erwähnung von Klopapiermangel datiert einen der Texte recht genau; und die allgemeine gesellschaftliche Zerrüttung, das schwindende Vertrauen in die Institutionen wird spürbar, wenn die Trennlinien zwischen den verschiedenen Instanzen verschwimmen, denen sich so eine Gesellschaftsinsassin gegenübersieht: Schon der Supermarkt erscheint als Ort autoritärer Herrschaft, und ausgerechnet die (wir vermuten) telefonischen Verhandlungen mit der Krankenkasse wirken sich aufs seelische Equilibrium so fundamental aus wie Rilke-Lektüren:
: Schadenersatz oder Aromatherapie in Zeiten von Corona? Ein jeder Engel ist schrecklich das schrieb schon Rilke so blieb ich liegen und fürchtete mich wieder in die Ruhe hinein: endlich Stille in mir
Es ist über diese inhaltliche Dimension selbst also wenig zu sagen – wir wissen eh. Diese Gedichte sind nicht ihres stofflichen Gehalts wegen interessant, sondern weil Sophie Reyers spezifische Sorte versprachlichter Selbstbeobachtung auf ihre Stoffe angewendet ist. Gesondert von diesen zwei Textsorten in CORONA. Ein Chor – den intertextuell verknüpften Biomacht-Sounds und den Gegenwartsgedichten – gibt es noch das Eröffnungsgedicht, mit drei Seiten deutlich länger als der Rest. Es gehört in beide Kategorien, oder in keine der beiden, und es organisiert sich zwischen Wiederholungen der Formulierung
Göttin von Morgen
in ihren unterschiedlichen Lesarten: der enjambierten, wo „Göttin“ und „Morgen“ kaum miteinander zu tun haben – so hier:
: Auch ohne die Schöpfung noch Göttin von Morgen Tau überm Kopf (…)
– dann der, wo wir es mit der „Göttin der Zukunft“ zu tun haben (was dann wieder ebenso gut „Frau Cyberpunk“ wie „Frau Moos-auf-Ruinen“ heißen mag), und dann der anderen mythologischen, es ginge ca. um die rosenfingerige Eos samt allem ikonographischem Ballast … Dass sich uns die genaue Natur der geschilderten Figur des „Morgens“ stets noch entzieht, passt eh hervorragend: Corona fragt: Wie müssen wir auf den Lauf der Dinge blicken, um zu kapieren, wie es unter den gegenwärtigen Alltagsbedingungen weitergehen soll?
Von nicht geringer Bedeutung ist schließlich der Untertitel des Buchs „Ein Chor“: Reyer inszeniert eine höchst zerbrechlich subjektive Stimme, und wir hören ihr eine sehr bestimmte Partikularität an, aber keine geringere Instanz als die Überschrift selbst insistiert auf der Allgemeinheit dessen, was diese Stimme sagt – oder halt darauf, dass wir uns das Gesagte als Produkt vieler und für die Lage typischer Subjekte denken sollen, wiedergegeben als Selbstgespräch eines fast-telepathischen hive-minds, zu dem wir uns (denkt sich der Rezensent dazu, dass Reyer uns sagen wollen könnte) im Zuge der Lockdowns sukzessive entwickeln.
Oder lesen wir das ganze gar als den „Chor“-Text im Sinn des attischen Dramas – wobei uns aber die Handlung des Stücks verborgen bleibt, ja wir nicht mal wissen, ob um uns eine Komödie oder ein Trauerspiel abläuft? Auch das passt, kurz vor Ostern 2021 gesprochen, ganz gut zu Corona.
Sophie Reyer: Corona. Ein Chor. Edition Melos, Wien 2021, 68 Seiten, Euro 20,-




