Udo Kawassers Lektüre des Gedichts „Der Stein“ von Michael Donhauser
Der Stein Unmöglich, in der Mehrzahl von ihm zu schreiben, ohne seine Einsilbigkeit zu verlieren, also formt er sich auch hier durch eine Reihe von Negationen. Er weist nicht durch Bruchstellen hin zurück, zeigt keine Kante, die nicht gerundet wäre, seine Herkunft ist getilgt durch den langjährigen Einfluss des Wassers. Seinem Widerstand ist so alles Augenfällige genom- men, alles Naheliegende wie etwa, ihn durch Entgegen- setzungen zu brechen. Er besteht auch gegen den Vergleich mit einer Kartof- fel, die geschält, verletzt von einem Spatenstich und an- gebohrt von einem vielleicht Wurm ihn erläutern könnte. Keine Haut, die ihn schützt, leicht angegilbt oder als milchglasklares Mosaik ähneln seine Felderungen und kaum Furchen nur denen einer Haut. Flächenweise heller, spiegelnd, sodass die Illusion einer Durchsichtigkeit entsteht, einer Zeit, bevor die stumme Gegenwart in ihm fest geworden ist, greifbar. Liegt er in der Hand, lässt er sie seine nie zu vollenden- de Form spüren, durch Drehen und Reiben nachvollzie- hen. Mit seinem Duft hält er das Vergänglichste noch fest, die erste Abkühlung am Beginn eines Gewitters, wenn es aufsteigt, fast dampft. Ansonsten kein Erinnern, nur die Lust, ihn zu werfen, seine Verhärtung über die Sprache hinaus wirksam zu machen. © mit freundlicher Genehmigung des Droschl-Verlags
Vom Erzählen der Dinge
Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass ein Ding in seiner Materialität und Eigengesetzlichkeit zum Gegenstand von Dichtung wird und nicht als Symbol für religiöse Vorstellungen oder als Allegorie oder Metapher fungiert. Hier ist nicht der Ort, den Weg durch die Jahrhunderte nachzuzeichnen, den es benötigte, damit die Dinge jenen Eigenwert erreichten, um zum vollwertigen Gegenstand dichterischer Beschäftigung zu werden, man geht aber nicht fehl, wenn man von mindestens drei Entwicklungen ausgeht, die das Terrain dafür bereiteten.
Der Mensch als Ding unter Dingen
Da ist zum einen der neuzeitlich naturwissenschaftliche Zugang mit der damit verbundenen Entmythologisierung und Dekontextualisierung, die den Verweischarakter der Dinge beinahe getilgt hat, und zum anderen die Entfremdungserfahrung der Moderne, deren kapitalistische Dynamik nicht nur zum „Verdampfen alles Ständischen und Stehenden“ und damit verbunden zu einer Schwächung des symbolischen Immunsystems führte, sondern auch den Menschen die triste Erfahrung bescherte, zu einem Ding unter anderen werden zu können. Mit der Entfaltung des kapitalistischen Marktes geht drittens ein Prozess der Autonomisierung der Künste einher, der die Materialität der Kunstmittel in den Blickpunkt rückt, bei der Dichtung also die Sprache selbst, was sich besonders in Frankreich, einer der fortgeschrittensten Gesellschaften des 19. Jahrhunderts, mit einem ersten Höhepunkt der Entwicklung bei Mallarmé zeigt.
Es ist daher kein Zufall, dass wesentliche Impulse für das Dinggedicht von Frankreich ausgingen, in der sich die nachromantische Literatur sehr stark an den Bildenden Künsten orientierte und Rainer Maria Rilke als Sekretär von Rodin mit seinen Neuen Gedichten zwischen 1902 und 1907 den Schritt zum Dinggedicht vollzog. Vergessen wir nicht, dass der wenig später einsetzende Kubismus sich zentral die Frage nach der Polyperspektivität der Dinge bildnerisch stellte und auf seine Art löste.
Francis Ponges Parteinahme für die Dinge
Ebenfalls in Frankreich, nur eine Generation später, war auch der größte Spracharbeiter am Ding beheimatet, Francis Ponge (1899 – 1988), der mit seinem Buch Le parti pris des choses (Parteinahme für die Dinge) von 1942 einen neuen dichterischen Kosmos öffnete, der in den deutschsprachigen Ländern erst in den 80ern durch einige Übertragungen Peter Handkes[1] weiteren Kreisen bekannt wurde. Bei Ponge wird das Schreiben zu einem Erforschen der Dingwelt, die aber stumm ist und der Versprachlichung Widerstände entgegensetzt. Nicht umsonst heißt sein zweiter bekannter Band von 1952 La rage de l’expression (Der Furor des Ausdrucks). Mit dem Bewusstsein, dass Wirklichkeit immer auch sprachlich vermittelt ist, wandte sich Ponge mit dem aufgeschlagenen LITTRÉ, dem Standardwörterbuch des Französischen, gegen den stereotypen und einfallslosen sprachlichen Umgang mit der Dingwelt und erschrieb sich an den Dingen entlang neue Sprach- und Denkräume.
Es ist allerdings das Verdienst Michael Donhausers, an Ponge anknüpfend die Dingwelt poetisch in der zeitgenössischen deutschsprachigen Literatur verankert zu haben. Während nach Thomas Bernhard Naturbeschreibungen „sowieso Unsinn[sind], weil ja jeder die Natur kennt“ und nur „innere Vorgänge, die niemand sieht“ literaturwürdig seien, hat Donhauser in seinen Büchern von Anfang an die Dinge und insbesondere die Natur in den Fokus seiner dichterischen Arbeit gerückt. 1990 erschien bei Droschl unter dem eigenwilligen Titel Die Wörtlichkeit der Quitte ein Band mit Prosagedichten aus den Jahren 1986-88. Im zweiten Kapitel mit der programmatischen Überschrift „Das Erzählen der Dinge“ befindet sich das Gedicht „Der Stein“, das im Folgenden im Mittelpunkt stehen soll.
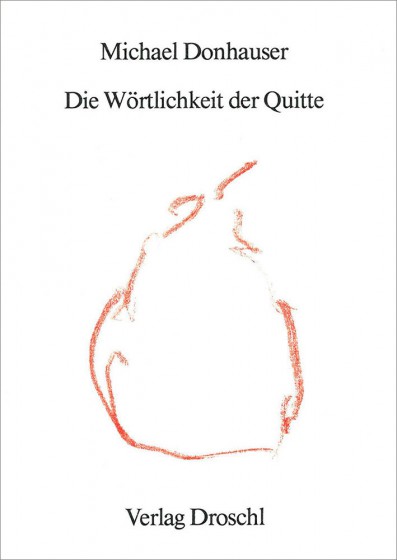
Das Erzählen der Dinge
Es ist allerdings das Verdienst Michael Donhausers, an Ponge anknüpfend die Dingwelt poetisch in der zeitgenössischen deutschsprachigen Literatur verankert zu haben. Während nach Thomas Bernhard Naturbeschreibungen „sowieso Unsinn[sind], weil ja jeder die Natur kennt“ und nur „innere Vorgänge, die niemand sieht“ literaturwürdig seien, hat Donhauser in seinen Büchern von Anfang an die Dinge und insbesondere die Natur in den Fokus seiner dichterischen Arbeit gerückt. 1990 erschien bei Droschl unter dem eigenwilligen Titel Die Wörtlichkeit der Quitte ein Band mit Prosagedichten aus den Jahren 1986-88. Im zweiten Kapitel mit der programmatischen Überschrift „Das Erzählen der Dinge“ befindet sich das Gedicht „Der Stein“, das im Folgenden im Mittelpunkt stehen soll.
Die Sprache als Gegenstand der Dichtung
Gleich im ersten Satz macht Donhauser klar, dass uns im Gedicht nicht das Ding in seiner Materialität, sondern das Wort, also das Ding als Sprache gegeben ist: „Unmöglich, in der Mehrzahl von ihm zu schreiben, ohne/ seine Einsilbigkeit zu verlieren“. Mit einer Trippelsinnigkeit, wie sie die poetisch geführte Sprache erlaubt, wird hier nicht nur die kurze Lautgestalt des Wortes „Stein“ evoziert, sondern gleichzeitig auch auf die monumentale Stummheit und In-sich-Verschlossenheit jedes Steins („Einsilbigkeit“) verwiesen.
Der Text beginnt schon im ersten Satz Fäden zu knüpfen, die eine multidimensionale Erfahrung von „Stein“ ermöglichen. Doch anstelle sich nun an den individuellen Merkmalen des Minerals abzuarbeiten, verbleibt der Text vorerst im Bereich des Logos: „also formt er sich auch/ hier durch eine Reihe von Negationen“. Das ist Prosa, die nüchtern den Gegenstand im „hier“ der Vorstellung hält, indem sie dem Stein abspricht, „Spuren seines Ursprungs“ zu tragen, was dem „langjährigen Einfluss des Wassers“ zuzuschreiben sei. Die spröde Ausdrucksweise hebt den operationalen Charakter des prosaischen Sprechens ohne Anspruch auf sprachliche Verdichtung hervor.
Von der Stummheit der Dinge
Im Gegensatz zu Menschen und sozialen Gegebenheiten, die sich im Medium Sprache ausdrücken können, erfahren wir die Stummheit der Dinge, ihr unerklärtes Sosein als Widerstand gerade in jenem Moment, in dem wir sie zur Sprache bringen wollen. Da dem rundgeschliffenen Stein das Kantige und Gebrochene fehlt, das am Anfang beim gewaltsamen Herausbrechen aus dem Gesteinszusammenhang sichtbar gewesen sein muss und ihm einst seine Individualität verlieh, lässt sich seine Widerständigkeit „augenfällig“ auf den ersten Blick nicht ausmachen. Doch noch im selben Satz zeigt sich, dass der „Widerstand“ ungebrochen und ihm auch ex negativo nicht beizukommen ist.
Seinem Widerstand ist so alles Augenfällige genom- men, alles Naheliegende wie etwa, ihn durch Entgegen- setzungen zu brechen.
Das ist allerdings rhetorisch zu verstehen, denn unsere Vorstellung ist dem Stein nach drei Sätzen schon bedeutend näher gerückt, ähnlich wie bei einem Bildhauer, der die Figur im Stein durch Wegschlagen alles dessen, was die Figur nicht ist, hervortreten lässt. Und so lässt auch die nächste „Entgegensetzung“ mit einem größenmäßig vergleichbaren Gegenstand den Stein in seiner Eigenheit weiter an Kontur gewinnen. Denn die Kartoffel, die hier den Bereich des Organischen vertritt, zeigt Verletzlichkeit und damit erzählbare Geschichten, sei es die Verletzung ihrer körperlichen Integrität durch einen „Spatenstich“ oder einen sie bewohnenden „Wurm“.
Einen Stein werfen
Damit ist das Gedicht seinem Gegenstand so nahe gekommen, dass es in einer letzten Negation vom Fehlen einer Haut „die ihn schützt“ sprechen kann. Der Stein gibt keine Nachrichten von seinem Inneren, von seiner Befindlichkeit. Auch die hellen Stellen, die „Felderungen“, die „die Illusion einer Durchsichtigkeit“ entstehen lassen, machen das opake Wesen des Steins nur deutlicher, auch wenn sie sein Zuvor, die Momente seines Sogewordenseins erahnen lassen. Entzieht sich auch die zeitliche Dimension des Steins dem Begreifen, so ist das Feld nun so weit bereitet, dass die unmittelbare sinnliche Evidenz des Steins zur Sprache kommen kann:
„Liegt er in der Hand, lässt er sie seine nie zu vollenden- de Form spüren, durch Drehen und Reiben nachvollzie- hen.“
Doch der Stein ist nicht nur haptisch erfahrbar, er hat auch einen Geruch, wenn im Sommer der Regen von ihm aufdampft. Und nicht zuletzt kann er vom Menschen auch als Teil des eigenen Tuns erfahren werden, wenn er ihn beispielsweise weit von sich wirft, womit das handelnde Subjekt in der Opakheit des Gegenstands ankäme.
Donhausers Prosagedicht ist nicht darauf gerichtet, einen einzelnen Stein in seiner Individualität hervortreten zu lassen, sondern schreitet sprachlich das geistige Konzept „Stein“ ab und verknüpft es mit unterschiedlichen menschlichen Erfahrungsmöglichkeiten, um es so zu einer neuen Kenntlichkeit zu bringen, die den Blick auf den Stein verändert und belebt. Das verschlossene Ding in seiner Widerständigkeit, um dessen Erzählbarkeit der Autor erfolgreich ringt, hat seine „Verhärtungen“, die es sprachlich unzugänglich machen. Sie korrespondieren aber mit einer realen Härte, die im Gedicht-Ich den Wunsch erwecken, über die Sprache ins Handeln zu kommen. Wer je einen Stein geworfen hat, weiß etwas vom Stein, das einem kein Blick, kein Wort an seiner statt erschließen kann.
[1] Francis Ponge: Das Notizbuch vom Kiefernwald. La Mounine. Dt. von Peter Handke, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1982.
Francis Ponge: Kleine Suite des Vivarais. Dt. von Peter Handke, Salzburg/Wien, Residenz, 1988.
Das Gedicht „Der Stein“ erschien in: Michael Donhauser: Die Wörtlichkeit der Quitte, Verlag Droschl, Graz, 1990, S.43




