Monika Vasik liest
der wackelatlas von H. C. Artmann
... ich schreibe ... das ist bei mir automatisch. Das fließt dann so raus. Manchmal stockend, manchmal wie ein offenes Fass, irgendwie, wie es kommt.
Runde Geburtstage verstorbener Literat*innen nimmt man gern zum Anlass, sich mit dem Werk einer Jubilarin, eines Jubilars zu beschäftigen. Im Jahr 2021 gab es dafür reichlich Gelegenheit. So konnte u. a. des 100. Geburtstags von Ilse Aichinger und Wolfgang Borchert, von Erich Fried, Friedrich Dürrenmatt, Patricia Highsmith oder Stanisław Lem gedacht werden. Auch der große Wiener Poet Hans Carl Artmann wurde 1921 geboren und wäre am 12. Juni letzten Jahres 100 Jahre alt geworden.
Kurz vor seinem Tod führten seine Tochter Emily und seine Nichte Katharina Copony mit ihm in Artmanns Wohnung Gespräche für ein von Kurt Mayer produziertes Filmporträt. Die erste Aufzeichnung fand am 28.9.2000 statt, die letzte am 30.11.2000. Artmann starb vier Tage nach der letzten Aufnahme mit 79 Jahren. Die elf Gespräche wurden zum dokumentarischen Vermächtnis des Dichters. Der Film erschien 2001 unter dem Titel „der wackelatlas – sammeln und jagen mit H. C. Artmann“ – ein beeindruckender Film übrigens, den man gesehen haben sollte. Nun legt der Ritter Verlag zum 100. Geburtstags des Dichters das Transkript der ungeschnittenen Filmaufnahmen in Buchform vor, was uns ermöglicht, Artmanns Stimme ohne Ablenkungen noch einmal auf uns wirken zu lassen, seinen Witz und seine Ernsthaftigkeit.
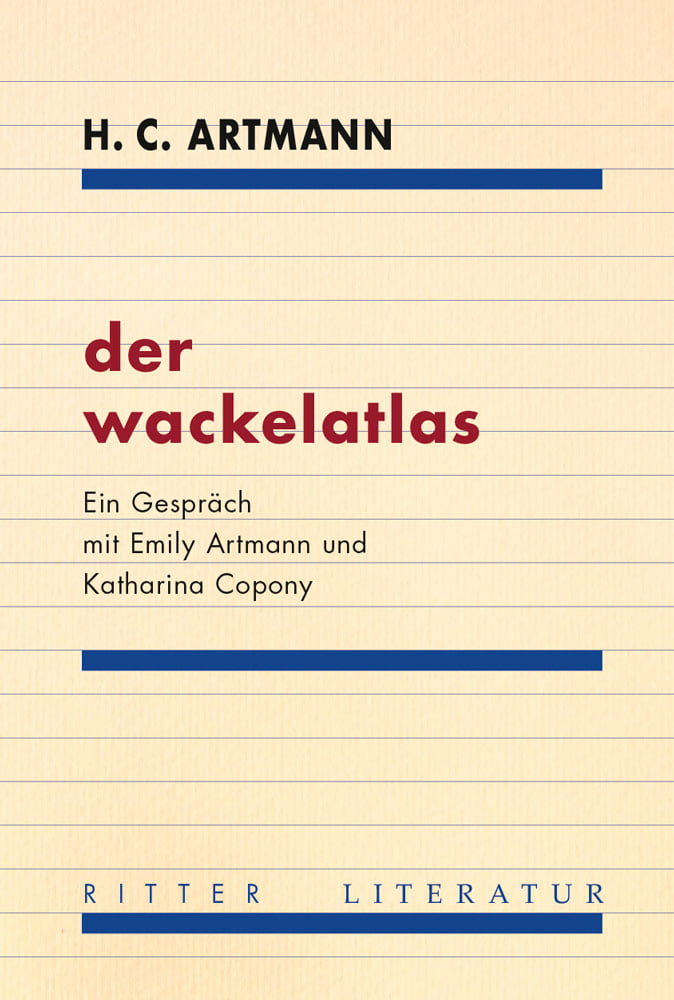
© Copyright Ritter Verlag
Ich schreib es so raus, wie es kommt. Bessere es vielleicht aus, ein bisschen schleifen, ein bisschen feiner machen, aber sonst schreibe ich es hin, aus der Maschine, wie es aus der Feder fließt, aus der Feder kann ich nicht sagen, wie es aus der Maschine entsteht.
der wackelatlas kann voraussetzungsfrei gelesen werden, erlaubt es sowohl Unkundigen, sich erstmals in den Kosmos des Dichters und Menschen einzulesen, als auch den vielen Kenner*innen, die eine oder andere Facette neu zu entdecken. Anrührend sind der persönliche, unaufgeregte Ton, die familiäre Atmosphäre, die von wahrhaftigem Interesse und Empathie zeugt, dabei aber nie ins rein Private abdriftet. Tochter und Nichte sind keine Journalistinnen, auch keine Literaturwissenschaftlerinnen, doch sie sind neugierig und fragen den Poeten, den Vater und Onkel nach seinem Leben und seiner Kunst. Fragen wie Antworten sind grundiert von Nähe und Fürsorglichkeit, von Erfahrungen des gemeinsamen Alltags über Jahre. Artmann selbst thematisiert dies während eines Interviews am 30.9.
H.C.: Was wir machen, ist eigentlich das Intimste, was ich gemacht hab. Rein intim. Ich meine, das ist viel intimer als alles andere, was wir machen da. Emily: Wie, was wir machen? H.C.: Was wir machen, jetzt. Diese Sätze und Aussagen. Das ist intimer als normal. Weil ich das mit euch besser machen kann als mit anderen. Emily: Und ist dir das eh auch angenehm? H.C.: Ja, es ist einmal etwas Neues.
„… etwas Neues“ ist ein bemerkenswerter Ausspruch eines 79-jährigen, der Offenheit beweist, eine Haltung, die im Buch immer wieder aufblitzt. Da sitzt etwa der Poet zunehmend eingeschränkt durch Alter und Krankheiten – er kann die Wohnung nicht mehr verlassen, ist abgeschnitten von außerhäuslichen Begegnungen – und denkt über die Segnungen moderner Entwicklungen nach. Er, der seine Texte nie mit der Hand, sondern mit der Schreibmaschine geschrieben hat, würde dafür heute, sagt er, einen Computer verwenden, weil „es praktischer ist“, man Fehler „sofort ausbessern“ kann und nicht mehr mühsam „aus-x-en“ muss. Oder er sinniert über die unterschiedliche Geräuschentwicklung beim Tippen auf der Schreibmaschine und der Computertastatur. „Computer ist mir absolut zu leise“, meint er, denn er brauche das „klatsch-klatsch-klatsch“ für das Beginnen des Flusses der eigenen Sprache. Artmann zeigt sich zudem begeistert, dass „ein Internetz erfunden worden ist“, weil es eine Hilfe sei. „Die Lust, etwas Neues zu machen“ brachte ihn auch dazu, beim Schreiben immer wieder formal zu experimentieren, wissend:
Man kann nichts Neues machen. Es ist alles schon einmal da gewesen. Wieder in anderer Form. Es ist immer ein neues Wortgut da. Es gibt interessanterweise Wörter, die ich noch nie geschrieben habe.
Interessant ist, was nicht in den Gesprächen erwähnt wird, etwa seine Auszeichnung mit dem Georg-Büchner-Preis 1997 oder Querelen im Literaturbetrieb, nur gestreift wird die Wiener Gruppe, werden seine zahlreichen Übersetzungen und die Vielfalt der eigenen Werke. Allein seinen Verdruss mit dem 1958 publizierten Gedichtband med ana schwoazzn dintn spricht Artmann an, weil er immer nur damit in Verbindung gebracht wird und das „geht mir auf den Wecker“.
In den Gesprächen erlebt man Artmann pur, einen Schriftsteller, der seinen Nachkommen Einblicke in ihm wichtige Aspekte seines Lebens schenkt, etwa seine Prägungen durch Kindheit und Elternhaus oder seine Widerfahrungen im Krieg und wie sie als Echos in seiner Dichtkunst präsent sind. Zwei große Themenbereiche stehen im Zentrum, die mit biografischen Einsprengseln und Kommentierungen garniert sind. Da ist zum einen seine Existenz als Dichter, dem schnell „fad“ wurde und der nach neuen Möglichkeiten des Dichtens suchte. Artmann erzählt in immer wieder neuen Anläufen, wie er zu dichten begann, warum er sich für Kleinschreibung entschieden, wann er seine erste Schreibmaschine bekommen, wann sich als Dichter begriffen und die ersten Texte veröffentlicht hat und warum er nie Romane oder Drehbücher schreiben wollte, denn
... ich bin einfach nicht der Mann für viele Worte.
Große Bedeutung hat für ihn die Natur („ich bin ein Naturdichter“), haben Gerüche, Farben, die Musik und der richtige Schreibplatz. Dieser müsse „ein sympathischer Ort“ sein, an dem er eingelebt sei, weshalb er nie in einem Hotelzimmer schreiben könne oder im Kaffeehaus, denn er sei „kein Kaffeehausliterat“. Wenn er an seinem Schreibtisch sitze, ihm ein Wort gut gefalle, ja
da kreise ich herum. Aber da brauche ich eine Schreibmaschine dazu. Zum Schreiben. Da brauche ich den Geruch, die Luft. Die Stimmung sowieso. Und eine Schreibmaschine. Ich brauche eine Schreibmaschine und einen Geruch. Da komme ich wieder auf das, was ich schon gesagt habe, dass man Gerüche verbinden kann mit Musik, also dass Musik eine Art Riechen ist.
Artmann gibt wiederholt Auskunft über den eigenen Schreibprozess und dass er als Material für seine Texte lieber „kompakte Wörter“ wählt, die man real anfassen kann, etwa einen Hammer, aber abstrakte Wörter nicht schätzt. „Sehr wichtig“ sei obendrein das Pathetische, man müsse nur wissen, „wo man es hinsetzt“, und das Verwerfen, sehr wichtig zudem Witz, Verfremdung und das Erfinden neuer Metaphern. Und
bei Versformen bin ich sehr streng. Das bin ich aber auch sehr spät geworden. Früher habe ich mir über Versformen auch kein Kopfzerbrechen gemacht. Aber jetzt – es ist sehr hilfreich, wenn man Versformen hat. Man muss sich irgendwie einpassen, in ein Korsett. Und da kriegt man dann andere Gedanken.
Das zweite Thema ist seine Sehnsucht nach fremden Ländern, seine Liebe zu Fremdsprachen und seine Reisen, etwa nach Schweden, Irland oder Berlin, auf denen er „wie ein Schwamm“ Eindrücke aufsaugte und diese als Konzentrate in seine Dichtung einfließen ließ. Auch in den Gesprächen wechselt er zuweilen die Sprachen, erläutert leidenschaftlich einzelne Worte und leitet sie von ihren Ursprüngen her. Er erzählt zudem von seiner Begeisterung für die Lyrik des Mittelalters und der Kelten, die Pracht der Barockdichtung, den Wiener Dialekt oder die schönen Sprüche in Grimms Märchen, allesamt Einflüsse, die seine Texte färbten.
Und thematisch sind meine Gedichte ja altmodisch. Sprachlich nicht. Das beruht aber wieder auf einem gewissen Nicht-Können. Wenn ich wirklich gekonnt hätte, hätte ich geschrieben wie Rilke, aber das wäre auch nichts. Ich bin da in völlig entlegene Gefilde gekommen, Barock und mittelalterliche Sachen. Oder völlig entlegene Kulturen. Aber das sind auch Abenteuer, Entdeckungsabenteuer.
H. C. Artmann: der wackelatlas. Ein Gespräch mit Emily Artmann und Katharina Copony. Ritter Verlag, Klagenfurt 2021. 160 Seiten. Euro 14,90




