Kirstin Breitenfellner geht es systematisch an und liest
Jochen Strobels Gedichtanalyse. Eine Einführung.
Vor dreißig Jahren schloss ich mein Studium mit dem Magistertitel ab. Als ich anfing zu studieren, gab es noch keine Literaturschulen. Wer Germanistik studierte, wollte entweder in den Schuldienst oder an der Universität bleiben, in einen Verlag oder eine Zeitung. Oder selbst schreiben. Ich hatte vor, Romanautorin zu werden. Und war erstaunt, als ich nach einer gewissen Latenzphase, in der der Wunsch in der Luft hing und nicht und nicht Wirklichkeit werden wollte, anfing, Gedichte zu schreiben. Vielleicht würde das nur eine vorübergehende Phase sein, überlegte ich. Eigentlich war ich mir dessen beinahe sicher.
Aber als ich dann, zehn Jahre später, meinen ersten Roman veröffentlichte, ging das Gedichteschreiben weiter. Mit zunächst großen Pausen, zwischen denen keine einzige Zeile zu greifen war – meine Gedichte beginnen meistens damit, dass mir, oft beim Aufwachen, eine erste oder auch zweite Zeile erscheint. Doch je mehr Romane ich schrieb, desto öfter stellten sich auch Gedichte ein. Ein Rätsel, dachte ich, bis ich mich daran erinnerte, dass meine Liebe zur Literatur eigentlich mit Gedichten begonnen hatte, mit Gedichten, die ich wieder und wieder las, weil sie mich zu Tränen rührten, gerade weil ich sie nie zur Gänze verstehen konnte. Hugo von Hofmannsthal, Georg Trakl, Ingeborg Bachmann, Else Lasker-Schüler hatten mich, vermittelt durch die Begeisterung von Lehrern und Professoren, ergriffen und ihre Kunst nie wieder losgelassen.
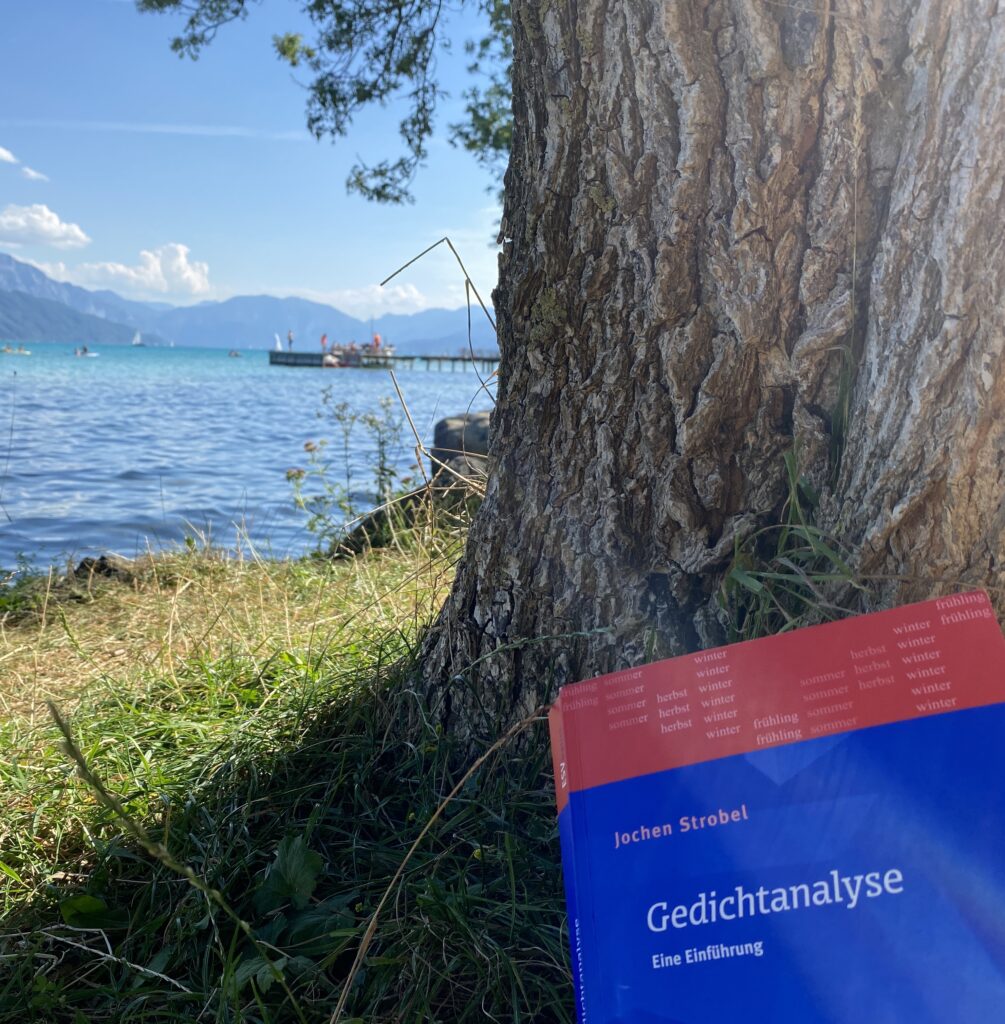
Das Studium an der Universität Heidelberg in den 1980er Jahren war so frei, wie man es sich heute kaum mehr vorstellen kann. Man besuchte die Vorlesungen, die einen ansprachen. Prüfungen musste man darüber nicht ablegen, schließlich studierte man das Fach ja freiwillig. Interesse wurde deswegen vorausgesetzt. Auch in den Seminaren setzte niemand auf Systematik, ich selbst schon gar nicht. Im Mittelpunkt stand das Kunstwerk. Wir nahmen ein Gedicht und interpretierten es gemeinsam zwei Stunden lang. Währenddessen lernte man von dem, was die Erfahreneren beitrugen. Auch auf diese Weise gelangt man zu Wissen. In dieses hatte ich immer vertraut. Beim Schreiben und beim Interpretieren von Romanen und Gedichten.
© Kirstin Breitenfellner
Aber warum nicht auch einmal systematisch an etwas herangehen, dachte ich, als ich die Betreuung von Lyrikrezensionen für die Poesiegalerie übernahm. Zum ersten Mal im Leben reizte es mich, eine Gesamtschau bzw. Einführung zur Hand zu nehmen. Ich entschied mich für Jochen Strobels „Gedichtanalyse. Eine Einführung“, Band 59 der Grundlagen der Germanistik aus dem Erich Schmidt Verlag, erschienen mehr als zwanzig Jahre, nachdem ich die Universität verlassen hatte. Ich las sie im Garten und am See, im Café und im Bett. Und siehe da: Sie war beinahe nie langweilig. Im Gegenteil. Sich die ganze Bandbreite dessen, was Lyrik vermag, sowie das vorhandene Instrumentarium, mit dem man ihre Ambiguitäten wenn nicht fassen, so doch abstecken oder einkreisen kann, vor Augen führen zu lassen, weckt Assoziationen und Erinnerungen, Neugier und Ideen.
Das beginnt mit der Relektüre von bekannten Lyrikdefinitionen wie der von Ezra Pound: „Große Literatur ist einfach Sprache, die bis zur Grenze des Möglichen mit Sinn geladen ist. Dichten = condensare.“ Oder von Günther Eich: „Lyrik ist überflüssig, unnütz, wirkungslos. Das legitimiert sie in einer utilitaristischen Welt. Lyrik spricht nicht die Sprache der Macht – das ist ihr verborgener Sprengstoff.“ Oder Gottfried Benn: „Ein Gedicht entsteht überhaupt sehr selten – ein Gedicht wird gemacht.“ So wie bei mir selbst, wenn die ersten beiden Zeilen erst einmal da sind. Der Rest ist Arbeit.
Traditionelle Lyrik mit ihren klaren Formen und wohlbekannten Inhalten macht es den Interpretinnen und Interpreten noch vergleichsweise leicht, deswegen kreisen die Reflexionen von Strobel vor allem um moderne Lyrik, die aufgrund ihres Hangs zur Uneindeutigkeit und ihres Potentials zur Verstörung für viele so unnahbar scheint. Tatsache ist, dass sogar viele Literaturkritiker keine Lyrik lesen, geschweige denn rezensieren. Dabei sind Gedichte doch so kurz? Warum werden sie in unserer schnelllebigen Zeit dennoch immer weniger rezipiert?
Lyrik sei eine elitäre Angelegenheit, meint Strobel. Das liege an ihrer Künstlichkeit, Bewusstheit und kritische Kontrolle sowie einer fortlaufenden Reflexion des eigenen Entstehungsprozesses. Ihre Anspielungen und Verfremdungen erforderten viel Vorwissen – sowie die Muße, sich auf ihre „Unverständlichkeit“ einzulassen. Man denkt an Immanuel Kants Begriff des „freien Spiels der Einbildungskraft“ für dieses zum Scheitern verurteilte Sinnergreifenwollen, das dennoch Lust verschafft. Strobel erinnert bei seinen vielen Definitionsversuchen auch an die Formel von Georg Wilhelm Hegel, der das Geheimnis der Lyrik mit dem Begriff der „Subjektivität mit reflektorischer Distanz“ einzufangen versuchte, die, wie Strobel meint, auch noch auf die zeitgenössische Lyrikproduktion zutrifft.
In jedem Kapitel analysiert Strobel beispielhaft Texte, die meisten sollten Lyrikversierten bekannt sein, und es ist schön, auf solche Weise alten Freunden wieder zu begegnen, wie etwa Hofmannsthals „Vorfrühling“, Trakls „Grodek“ oder Bachmanns „Die gestundete Zeit“. Aber auch Entdeckungen sind dabei, wie etwa die sorbisch-deutsche Lyrikerin Róža Domašcyna. Der Germanist würdigt den Zug von Lyrik zur Intermedialität und den intuitiven Anteil der Gedichtlektüre. Er analysiert ihre Tendenz zum magischen Denken: die Postulierung von Kohärenz bei wahrscheinlicher Kontingenz, sprich die Herstellung von Zusammenhang, wo keiner besteht. Und er betet die wichtigsten Gedicht- und Versformen durch. Theorie und Praxis halten sich in dieser Einführung gut die Waage. Aber auch das Verstehenwollen und die Ermunterung (seines eigentlich studentischen Zielpublikums) zum Stehenlassen von Ambivalenzen. Sein Buch vermag damit zum Interpretieren von Gedichten zu animieren. Aber auch dazu, die Theorie wieder hinter sich zu lassen – und wieder selbst Gedichte zu schreiben.

Jochen Strobel: Gedichtanalyse. Eine Einführung. Erich Schmidt Verlag, 2015. 348 Seiten, Euro 20,50




