Timo Brandt liest Alexander Peers Gin zu Ende, achtzehn Uhr
Stets öffnet sich ein neues Blatt in diesem Universum der unbeschriebenen Blätter, die der moderne einfache PC nun mal bereithält. Es heißt Unbenannt I. Besser könnte das Unbewusste nicht beschrieben werden, das aus jedem unbeschriebenen Blatt spricht. Aber wenn es beschrieben ist, das Blatt, erzählt es dann nicht auch – verdeckt und offen zugleich – vom Unbewussten?
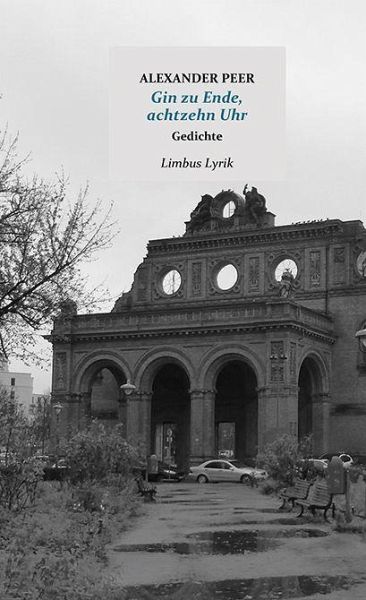
Ich eröffne diese Besprechung von Alexander Peers Gin zu Ende, achtzehn Uhr mit diesem Zitat, weil darin viele der Probleme und Schwächen (und Potenziale) aufscheinen, die mir bei der Lektüre immer wieder aufgefallen sind. Auf die Stärken werde ich später aber auch noch zu sprechen kommen.
Cover © Limbus Verlag
Eine der Schwächen, die sich hier zeigen, ist die mitunter lapidare, unpräzise Handhabung der Sprache – angefangen bei den Blättern/Textdokumenten, die sich nicht öffnen, sondern die geöffnet werden. (Es wäre ja auch spannend, dieser Handlung nachzugehen: Warum öffnen wir immer wieder ein neues Dokument? Was gibt uns dieses ganz und gar Weiße? Und warum ist dieses Universum in DIN A4 formatiert?) Warum Peer dem PC die Adjektive „modern“ und „einfach“ voranstellt, erschließt sich mir nicht; sie präzisieren weder, noch erweitern sie den Begriff, das Motiv. Dass der PC die Textdokumente „nun mal bereithält“, auch damit ließe sich einiges machen – so dahingestellt macht der Halbsatz aber wenig mit den Leser*innen und wirkt überbetont leger. Dass das Unbewusste nicht „besser“ beschrieben werden könnte, diese Behauptung fällt für viele sicher in die Kategorie der in der Poesie erlaubten Übertreibung; ich finde, es hätte gereicht zu sagen, dass es eine gute/gelungene/etc. Beschreibung (wobei hier eher „Umschreibung“) des Unbewussten ist, und meine, der Superlativ ist hier ein Lauterdrehen der Musik zum falschen Zeitpunkt. Gegen die Wendung „wenn es beschrieben ist“ könnte ich noch die Konjunktion „sobald“ ins Feld führen, aber da begeben wir uns dann auf eine ganz neue Ebene von grammatikalischer Pedanterie, für die ich hier auch nicht eintreten will (allein schon, weil meine eigenen Texte ihr niemals standhalten würden).
Leider ist diese Stelle nicht die einzige, in der diese Handhabung der Sprache sichtbar wird. Es geschieht vor allem dort, wo Peer eine argumentative, diskursive, fast schon agitative Rhetorik bemüht (was in etwa einem Viertel der Gedichte der Fall ist).
Hintergründiges im Vordergrund
Ein weiteres Stilelement des Bandes, das sich im ersten Zitat zeigt, ist der Zug zum Hintergründigen. Hier gibt es auch einige positive Beispiele. Aber in Summe vertraut Peer zu selten darauf, dass sich das Hintergründige in der Sprache selbst entfaltet, und versucht mit Mitteln der Argumentation oder einer (allzu beifallheischenden) Anschaulichkeit zu den Hintergründen vorzudringen. Aber wenn man zu den Hintergründen vordringt, dann sind sie halt keine Hintergründe mehr, haben nichts Hintergründiges mehr, sondern sind im besten Fall offensichtlich, im schlimmsten Fall plakativ. Ich will gar nicht entscheiden, wie es mit dem Anteil an Unbewusstem im Weiß des Papiers ist, ob wir es da mit einer Binsenweisheit zu tun haben oder einer klug-lässlichen Anmerkung (zumal das Gedicht noch weitergeht). Fest steht, dass ich manches Gedicht von Peer frustriert oder sang- und klanglos verlassen habe, obwohl ich mich durchaus mit einigem Frohlocken hindurchbewegt habe, weil die Ideen und Ansätze vielversprechend wirkten. Das lag oft daran, dass der Autor seine Leistung im Gedicht über die Maßen hervorheben wollte und dabei keinen Platz für meine Leistung – das Lesen, das Auffinden und Verbinden, die Rezeption – ließ.
Daran schließt sich nahtlos das letzte Problem an (oder ergibt es sich daraus, fällt es damit zusammen?): der Duktus der Gedichte, auch abseits der ersten beiden Phänomene. Er erscheint mir nämlich oftmals vereinnahmend, in seltenen Fällen geradezu wichtigtuerisch (über die provokante Note, die die Texte dann und wann haben, kann man streiten – ich finde sie durchaus erfrischend, aber leider selten erhellend). Auch hier werden manche zu Recht anmerken: Das kann man sich als Dichter*in schon herausnehmen. Kann man eh. Aber mich stört es in diesem Fall, auch weil ich mich weigere, in diesem Streben nach einem ständig souverän erscheinenden lyrischen Ich so etwas wie gesundes Selbstbewusstsein oder ein notwendiges Risiko zu sehen; es ist schlicht eine enervierende Zelebrierung. Das zeigt sich vor allem dann, wenn die Texte Fragen aufwerfen, sich in Zweifeln bewegen, dann aber mit einem Mal in einer Antwort gipfeln, sich hin zu Gewissheiten verengen, in eine Auflösung münden. Man könnte auch sagen: Ein übertriebener Versuch der Kontrolle über Wirkungsgrad und -richtung der Gedichte schränkt die Gedichte ein.
Peer selbst hat Teile dieser Problematiken sehr schön in der letzten Strophe eines Gedichtes zusammengefasst (unbewusst?):
Vom höchsten Aussichtspunkt, dem Jägerstand formvollendeter Reflektion, erkenne ich das Land um mich und kann es doch nicht begreifen
Eine ehrliche und kluge Einsicht, nur leider handelt Peer nicht in jedem Gedicht dieser Einsicht entsprechend.
Die Schönheit der schlichten Begegnung
Aber es gibt auch andere Beispiele. Gedichte, in denen das Begreifen hinter das Beschreiben und Betrachten zurücktritt (in denen ein eigenes Begreifen liegt, eines, das den Leserinnen auf vielfältige Weise offensteht; wenn ihnen dieder Dichter*in eines vorschreibt, war’s das nämlich mit der Vielfältigkeit).
Wir leben vermutlich unbeobachtet, weder ist die Sünde eine solche, noch ist der Triumph mehr als das, was wir in diesem Moment zu empfinden fähig sind. Die Bühne, auf der wir engagiert sind, verzichtet wohl aufs höhere Auditorium. Wir spielen für uns. Immer für einander.
Am stärksten sind Peers Gedichte dort, wo sie sich nicht hervortun wollen mit besonderen Erkenntnissen oder Bildern oder Provokationen, sondern wo sie in ihrem Gegenstand aufgehen (statt ihn überwältigen, festmachen zu wollen). Es gibt ein großartiges Gedicht mit dem Titel „Dein Gesicht für immer bei mir (für O.)“, wohl für einen Verstorbenen geschrieben, das endet mit den Zeilen:
Dein Gesicht späht mir in vielen Gebärden nach. Ich nehme deine Gesichter mit in andere Geschichten. Dein Gesicht nun fern, schaut so verschieden mir nach. Du mir Vorfahrender, der mir einst das Ticket zusteckte
Schlicht die Bilder und doch vielgestaltig, offen und doch so präzise. In allen Gedichten, in denen es (im weitesten Sinne) um Liebe geht, sind diese Offenheit und Klarheit nebst einiger Sprengsel von Albernheit, Virtuosität und Ambivalenz federführend. Diesen Gedichten kann man wirklich begegnen, sie reden nicht auf einen ein oder verlangen eine konkrete Reaktion von einem.
„Ich wäre gerne die Nachsicht zwischen den Menschen“, heißt es an einer Stelle. In vielen Momenten in diesem Gedichtband frage ich mich: Aber wo ist die Umsetzung dieses großartigen Gedankens, dieses Wunsches? Vielleicht ist auch meine Nachsicht gefragt, Nachsicht mit dem Dichter Alexander Peer, der sich halt ausprobieren mag, der alles in seiner Poesie verarbeitet, von tiefen Gefühlen über kleine und große Ärgernisse bis hin zu spitzbübischen Ideen. Ich empfinde den daraus entstandenen Mischmasch stellenweise als unausgegoren. In anderen Momenten blühen auf diesem Mischmasch schöne Pflanzen in zarten bis kräftigen Farben. Vielleicht hält auch das Unausgegorene für die richtigen Leser*innen genau den Nährboden bereit, auf denen ihre Freude oder Gedankenwelt gedeiht. Das will und kann ich nicht ausschließen. Zumal ich zugeben muss, dass sich die Lektüre schon allein wegen der Liebesgedichte gelohnt hat.
Alexander Peer: Gin zu Ende, achtzehn Uhr. Gedichte. Limbus Verlag, Innsbruck, 2021. 96 Seiten, Euro 15,–




