Lukas Meschik liest Eugen Roths Sämtliche Menschen
Bis vor wenigen Wochen war mir der Name Eugen Roth völlig unbekannt. Es mag daran liegen, dass er in Österreich – wie man so sagt – keine große Nummer ist, oder an etwas Banalem wie meiner Ignoranz und den Zufällen des Lebens. In Deutschland, so habe ich mitbekommen, ist der Lyriker Eugen Roth ein Held und Topseller, und seine humoristischen Verse sind nach meinem Empfinden auch sehr deutsch. (In einem meiner eigenen Gedichte heißt es wo: Etwas oder jemand ist so deutsch / Dass es schon fast wieder geht. Ich meine das selbstverständlich als augenzwinkernde Liebeserklärung.)
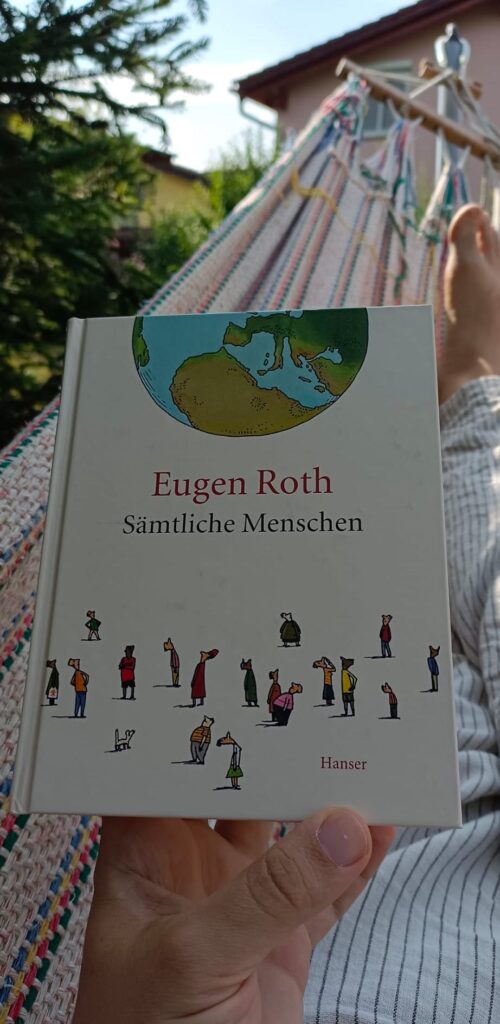
Geboren 1895 in München, gestorben 1976 ebendort, hat Roth beide Weltkriege überstanden, im Ersten wurde er schwer verwundet, im Zweiten eingezogen und zur Truppenbetreuung auf Lesereise geschickt. (Aber genug der Biographie. Der Roman seines Lebens sollte unbedingt geschrieben werden, Freiwillige vor!) Es sei bloß noch erwähnt, dass seine Bücher hunderttausendfach verkauft wurden, sein 1935 erschienener Erstling erreichte eine Auflage von knapp einer halben Million Stück.
Foto © Lukas Meschik
Vielleicht ist es nur folgerichtig, dass jemand, der ins Herz der Finsternis blickt, als letzte Waffe einen garstigen Humor dagegen auffährt. Jedenfalls hat Roth allen vorstellbaren und noch mehr unvorstellbaren Schrecken erlebt, Kriegsgräuel und Hunger und Not, er weiß, was Menschen einander antun und was sie aushalten können, und dass es irgendwie trotzdem immer weitergeht. Er hat die Menschen durchschaut und etwas über sie zu sagen, seine wichtigsten Gedichtbände heißen also Ein Mensch, Mensch und Unmensch und Der letzte Mensch. Versammelt ist diese Trilogie des Menschseins im gewitzt betitelten Sämtliche Menschen, das mir in der Sommermitte ganz zufällig in Deutschland (Hessen) empfohlen wurde, und zwar von einer griechischen Regieassistentin, die damit ihren Wortschatz aufpolierte – beim Erzählen von ihrem deutschsprachigen Lieblingsautor blitzte in ihren Augen die gute Laune auf.
Ich las die knapp dreihundert unterhaltsamen Seiten in Windeseile, ein Buch-Binge, wie man ihn nur vollzieht, wenn das Geschriebene einen selbst meint. Hier endlich eine kleine Kostprobe:
Brotlose Künste Ein Mensch treibt eine rare Kunst, Von der kaum wer hat einen Dunst. Der Welt drum scheint sie zu geringe, Als daß, selbst wenn nach Brot sie ginge, Sie dieses Brot sich könnt erwerben – Doch Gott lässt diese Kunst nicht sterben. Nie könnt sie ihren Meister nähren, Würd der sie nicht die Jünger lehren, Die, selber brotlos, wiederum Beibringen sie den Jüngsten drum. So brennt die Kunst als ewiges Licht, Durch fortgesetzten Unterricht. (S. 102)
Ich dachte beim Lesen sofort an die in sich geschlossenen Systeme der Schauspiel- und Musikschulen, neuerdings auch vermehrt der Schreibschulen, wo die Dozenten ihre Nachfolger ausbilden und der Außenstehende sich fragt, wie viel echte Welt da beim Lüften noch hereinweht, wer sich mit dem, was er da unterrichtet, in freier Wildbahn tatsächlich beweisen musste. Ganz viele dieser jahrzehntealten Gedichte behalten eine Frische, indem sie genau den Sweet Spot zwischen konkret und allgemeingültig erwischen, also eine Situation oder eine Figur beschreiben, der wir selbst einen Handlungsort oder ein Gesicht aufmalen.
Roths Gedichte beginnen allesamt mit der Anhebung „Ein Mensch“, Eigennamen sucht man vergeblich. Erstaunlicherweise nutzt sich diese formelhafte Rahmung nicht ab, sondern entwickelt einen heimeligen Sog. Ein Mensch spricht fern, ein Mensch glaubt, ein Mensch sitzt da – im Kopf des Lesers verwandeln sie sich in den eigenen Bruder, die eigene Freundin, in einen selbst. Immer wieder musste ich Gedichte mit dem Handy abfotografieren und jemandem zur Erheiterung schicken. Hat zum Beispiel jemals jemand das Phänomen der Teuerung und der Shrinkflation so präzise auf den Punkt gebracht? – und auch so, dass man nicht verzweifelt, sondern in bitteres Lachen verfällt:
Entwicklung Ein Mensch kriegt’ einst (und fands zu teuer!) Ein wahres Schnitzel-Ungeheuer. Dann wards allmählich immer kleiner, Dann zahlte zwei Mark er statt einer. Dann schrumpfte neuerdings es stark. Dann wieder stieg es auf drei Mark. Dann wars nur noch ein Gaumenkitzel. Dann kostete vier Mark dies Schnitzel. Das Wechselspiel geht immer schneller: Fünf Mark für beinah leeren Teller. Von Wirtschaftswunder-Schmus umgaukelt, Wird es dem Nichts so zugeschaukelt. Zuletzt – der Himmel mög uns schonen! – Gibts wieder gar keins – für Millionen! (S. 255)
Wir müssen bedenken, dass wir derzeit bei allen Beschwernissen, die auch mir vertraut sind, ja insgeheim eine Pimperl-Krise erleben, verglichen zum Beispiel mit der deutschen Inflation von 1914 bis 1923, einer der radikalsten Geldentwertungen in einer großen Industrienation, da braucht es dann schon mal einen „100 Billionen Mark-Schein“. (Billion mit B, also eintausend Milliarden oder eine Million Millionen. Da wird mir vor lauter Nullen ganz schwindlig.) In welche Katastrophen wirtschaftliche Schieflagen solchen Ausmaßes münden, steht als dunkle Kapitel in den Geschichtsbüchern. Es grenzt an ein Wunder, dass Eugen Roth solchen Vorgängen, die er am eigenen Leib erfahren musste, derartige Zeilen abgewinnen konnte. Ich glaube, es gibt ein Lachen, das nur lacht, wer nichts mehr verlieren kann; es stellt sich dort ein, wo man vor Kummer eigentlich tot umfallen sollte. Wir kennen es nicht, und lernen es hoffentlich niemals kennen.
Die Gedichte sind sehr streng gearbeitet, fast zwängerlisch – das meinte ich anfangs mit „deutsch“. Das Versmaß wird ganz genau eingehalten, übergenau, dass einem phasenweise die Luft knapp wird. Roth verließ sich auf diese Strenge, um dem Wahnsinn des Daseins eine Form geben zu können. Ohne strenge Form würden wir den Verstand verlieren.
In vielen Texten geht es um Menschen, denen ein Missgeschick passiert, auch um die Ärgernisse des Reisens und der Technik (ob es wie früher ein Fernsprecher war oder wir uns jetzt mit unseren Smartphones herumschlagen, ist zweitrangig, das zwischenmenschliche Element und die Ärgernisse bleiben im Kern die gleichen), oft beobachten wir Zukurzgekommene und Übersehene, traurige Helden des Alltags, die ihren Frust in sich hineinfressen. Hier erkenne ich mich so gut wieder, dass ich mich vor Schadenfreude und Selbsterkenntnis zerkugle. Eugen Roth schreibt über Menschen in allen Facetten und Schattierungen der Entfremdung – seine Gedichte seien all jenen empfohlen, die sich selbst als Vertreter der Spezies Mensch erkennen und hin und wieder lustvoll damit hadern.
Schließen möchte ich mit einer luziden Analyse diverser Gerichtsverfahren, die handelnden Personen soll bitte jeder nach Geschmack selbst einfügen, ob nun BUWOG- oder BAWAG-Affäre, Causa Grasser oder Wirecard-Prozess. Eugen Roth liefert uns die launige Schablone:
Einsicht Ein Mensch beweist uns klipp und klar, Daß er es eigentlich nicht war. Ein andrer Mensch mit Nachdruck spricht: Wer es auch sei – ich war es nicht! Ein dritter läßt uns etwas lesen, Wo drin steht, daß ers nicht gewesen. Ein vierter weist es weit von sich: Wie? sagt er, was? Am Ende ich? Ein fünfter überzeugt uns scharf, Daß man an ihn nicht denken darf. Ein sechster spielt den Ehrenmann, Der es gewesen nicht sein kann. Ein siebter – kurz, wir sehens ein, Kein Mensch will es gewesen sein. Die Wahrheit ist in diesem Falle: Mehr oder minder warn wirs alle! (S. 123)

Eugen Roth: Sämtliche Menschen, Carl Hanser Verlag, 1983, 2006, 2012.




