Stefan Schmitzer liest Reinhard Lechners Portraits mit Riesenkalmar
Dies sind, der Titel trügt nicht, tatsächlich Portraits mit Riesenkalmar, nämlich genauer, dies sind alles Gedichte, die eine Figur präsentieren, meist eine menschliche, und immer vor dem Hintergrund von und in Bezug auf allerhand Natur und Kreatur. Nicht alle, aber die meisten sind Erzählgedichte in dem Sinne, dass sie Lebensgeschichten schildern oder auch nur eine aussagekräftige einzelne Szene, jedenfalls einen Vorgang, der auf das Sichtbarwerden der Figur hinzielt.
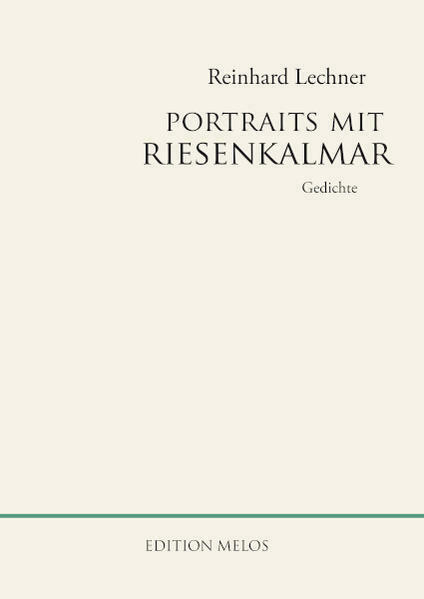
Wenn wir das Album nun durchlesen, das Reinhard Lechner damit vorlegt, sind dementsprechend mindestens zusammenzudenken: einerseits die – ca. spätbarocke und bürgerlich-klassische – Porträtmalerei samt den weltanschaulichen Quellen ihrer Abbildungskonventionen (Emblembücher, Blumensprache, Stillleben, widerstreitende ethische Modelle, Ideen vom Sehen etc.) und andererseits die Ästhetik der zeitgenössischen Lyrik.
Cover © Edition Melos
Zu den zahlreichen intertextuellen Bezügen auf den klassischen und biblischen Kanon kommen dann noch die spezifisch deutschsprachigen, jetzigen und/oder popkulturellen. Jedes Tier, das da vorkommt, verdankt seine jeweilige Funktion im Gesamtensemble des Gedichts den ubiquitären, in Fleisch und Blut übergegangenen Topoi (klassisch) bzw. tropes (Fernsehzeitalter); oder es verhält sich doch erkennbar zu ihnen.
Lesbar, weiterweisend, lesenswert
Die Dohlen zum Beispiel, die in dem grusigen Epitaph über einen „jens hartmann“ an dessen Leichnam pecken – nein, nicht dem des prominenten Tatort-Schauspielers Jörg H., wie der Rezensent zuerst dachte, sondern dem eines einsam Verstorbenen irgendwo am Land: Sie erfüllen ihre allegorische Zuschreibung als doppelgesichtige Spötter, als Verschwörer hinter vorgehaltener Hand und als Unter-sich-bleiben-Wollende mit Leben, und in der Szenerie werden etwa Ausschlussmechanismen in Dorfgemeinschaften sichtbar, die ein Leben geprägt haben. Derlei kann dann vom/von der Leser:in, der:die sich auf den ganzen Text einlässt, viel detaillierter interpretiert werden. Die Dohlen z. B. machen auch noch was, sie hinterlassen Spuren, die sich zu anderen Elementen in der Landschaft irgendwie verhalten; alles lesbar, weiterweisend, lesenswert.
Obwohl das bisher über Lechners Verfahrensweisen Gesagte auf alle fünfundzwanzig Gedichte zutrifft, erscheinen mir überraschenderweise ein paar von ihnen, vielleicht fünf, (im zeitgenössischen Idiom gesprochen) cringe. Es scheint sich mir mit anderen Worten ein Missverhältnis oder zumindest eine kalkulierte Fallhöhe zwischen dem absichtsvoll Klassischen dieser Gedichte und einigen der ausgebreiteten Sachverhalte aufzutun. Der Text „über das ei“ etwa über einen jugendlichen Tyrannen, der auf ein befruchtetes Vogelei aufpasst, beginnt so:
noch heute steht er baumhoch vor mir der schläger patrick, wie er von hinten die arme unserer außenseiter griff ,sie ohrfeigte, kinnhakte damit – (…)
Und ich brauchte tatsächlich meine Zeit, bis mir klar war, was mich daran störte. Der Textfluss des Buches bis genau zu dem Wort „außenseiter“ in diesem fünften Gedicht der Sammlung erweckt (bei mir) den (vielleicht täuschenden) Eindruck, es solle nichts darin Ausgesprochene nur von den Themen und Diskursen unserer Generation (+/- 20 J.) her zu verstehen sein, sondern als habe es gewissermaßen auch den Anspruch, ohne notwendigen Zwischenschritt, von der Weltwahrnehmung etwa der gelehrten Gebrüder Grimm oder einer Mary Shelley her greifbar, einsortierbar zu sein.
Die Grenze zwischen Porträtmalerei und Nature-Writing
Gut, auch zuvor schon gibt’s im Text ein „selfie“ u. Ä., aber das sind bloß neue Sachen, die in der geschilderten Welt eben sachlich vorkommen – die Rede von „unseren außenseitern“ aber verbindet eine Art von Alltagsabstraktion und Gruppenpsychologie, die aus dem Goldgrund gewissermaßen herausfallen. Ähnliches ereignet sich noch an ein paar anderen Stellen. Die Wirklichkeit, gerade die sprachlich sedimentierte, ist konkret, wird sich also nicht verlässlich auf die Erfordernisse der Emblematik und Porträtkunst herunterbrechen lassen. „Truth is cringe“, könnte man sagen, und die Empfindung davon wird uns, wohlverstanden, als Signal dafür dienen, dass eine künstlerische Arbeit eben nicht nur vor einem Hintergrund steht – einem Referenzrahmen, einen Vorrat an Abzurufendem, einer Stoff- und Ideengeschichte –, sonden auch in einer Gegenwart, in der Leute leben.
Der eine Text, in dem der Verfasser dieses Verhältnis von dem, wonach der Ton klingt, und dem, was die Worte aufzeichnen, nicht bloß andeutet, sondern explizit und komisch inszeniert – „im hinterkopf“ – ist meiner Meinung nach der gelungenste. In ihm tönt es so:
(…) war’s intuition? gerhard kam davon ohne kratzer, fall zum waldrand, der bär wartete schon, brüllte, als er ihn roch, schlug mit der pranke, unser held hielt keinen arm lang vorm maul, tiefenentspannt, nicht den winzigsten schrecken – was, wenn wir immer so lebten: der körper, die handlungen gehören nur halb uns, selbst informatik döst, gibt sich hin, folgt dem narrenkästchen, aus einer welt glimmend tief aus uns, in uns? (…)
Reinhard Lechners Porträtsammlung vermittelt nicht so sehr zwischen den Denkwelten von artifizieller Porträtmalerei und von jenem auf Bruchlosigkeit abgestellten Nature-Writing, über das wir in den letzten Jahren so viel hören – sie inszeniert vielmehr die Frage, ob die Grenze zwischen dem einen und dem anderen (dem symbolisch und diskursiv Überdeterminierten und dem, s. o., cringen und Unmittelbaren) immer erkennbar sein muss.
Ich lese das Buch gerne und denke mir die einzelnen „Portraits“ dabei in Öl, vor dunklen Hintergründen, im Stil des flämischen Barock – Dohlen, Selfie, Informatik und alles.
Reinhard Lechner: Portraits mit Riesenkalmar. Edition Melos, Wien, 2022. 80 Seiten, Euro 22,–




