Katharina J. Ferner liest Sue Goyettes Ozean als Sommerlektüre
Der Sommer ist mir häufig gedanklicher Sehnsuchtsort. Ein Sinnbild: jegliche Form von Gewässer. Dazu gehören auch Bücher, die sich mit Wasser auseinandersetzen. So findet sich in meinem Sommerstapel beispielsweise Sprache und Meer von Nasima Sophia Razizadeh oder Böhmen ist der Ozean von Rhea Krčmářová. Und dann spült der nahe gelegene Fluss mir plötzlich Sue Goyettes Ozean an. Übersetzt wurde dieses Buch von zwei Poet*innen, deren Werke ich ebenfalls sehr empfehlen kann: Michael Stavarič und Romina Nikolić.
Bis ich jedoch zum Lesen komme, trage ich es den Lyrikband ein wenig mit mir herum. Er reist mit mir zwischen Wien und Salzburg hin und her, immer obenauf im Gepäck, bis ich irgendwann Gartenruhe finde.
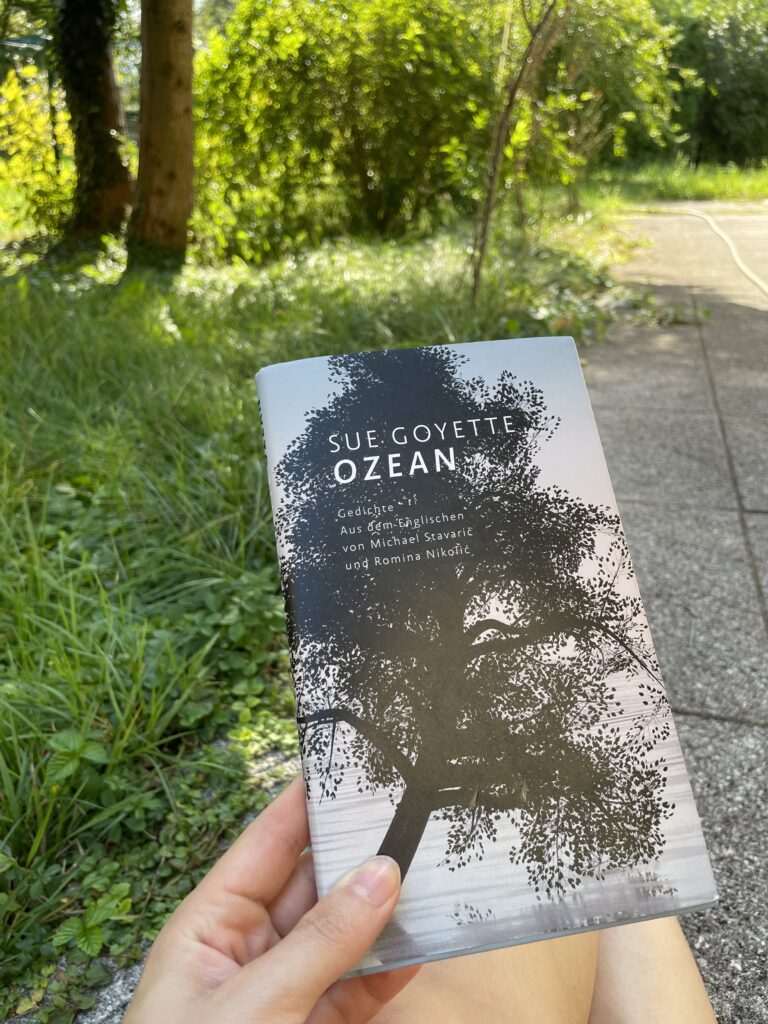
Da mein Fokus häufig auf Lyrik aus dem deutschsprachigen Raum liegt, bietet die Lektüre der Kanadierin Sue Goyette für mich ein zusätzliches Abenteuer. Aber ich scheue mich mehrfach ihn aufzuschlagen, weil die Kraft des Ozeans, das bemerke ich sofort, zwischen den Seiten Schaumkronen ansetzt. Und ich ahne, dass er mich unmittelbar einsaugt, wenn ich nicht aufpasse.
Cover © Katharina J. Ferner
Als ich es endlich wage, geht es mir so, wie den Protagonist*innen im Buch: Ich muss mich den Gezeiten anpassen.
Die Dichter versenkten ihre Stifte in der Stille des Nichtwissens und schrieben Briefe an die Zukunft, in kleinen Strophen, die sich vornehmlich in Vogelbildern auflösten. Selbst unsere Kinder, groß wie sie waren, konnten nichts von dem erkennen, was auf uns zukam. Und der Ozean, nun, der Ozean war ein gescheitertes Experiment. Wir konnten ein ganzes Haus hineinwerfen, im Austausch für das, was er wusste. Er bewegte sich zwar, doch gab er dennoch in nichts nach. Sue Goyette: Ozean, Neunzehn, S. 40/41
Seine Unnachgiebigkeit macht den Ozean zwar bedrohlich, gleichzeitig ist sie eine Anerkennung seines Fortbestehens. Die Vorstellung den Ozean auf irgendeine Weise einschränken zu können, sei es durch bauliche Maßnahmen oder Beschwörungsformeln wird schnell widerlegt. Die Menschen, die seine Ufer bewohnen, können sich ihm nur beugen. Mit Anrufungen, Wünschen und Ritualen verleihen sie ihm etwas Göttliches. Er wird für allerlei Begebenheiten verantwortlich gemacht, wie gelingende Beziehungen, manch einer erhofft sich sogar einen Blick in die eigene Zukunft. Sein Wirken bedient sich der Sprache seiner Protagonist*innen, wie „wenn die Kinder Zeit nach Körnchen messen, wenn sie unglücklich sind und wenn sie glücklich sind nach Strand. Wenn ihre Freude in Fluten kommt und ihr Ärger in Wellen.“ (vgl. S.60, Dreissig). Die beschriebene Gegend wirkt so mystisch, dass sie einem wie ein unwirklicher Ort vorkommt. Dort wird Nebel in Dosen am Schwarzmarkt verkauft und Dichter nehmen selbstverständlich an Stadtversammlungen teil. Der magische Küstenstreif entspringt jedoch nicht nur der Fantasie der Autorin.
In einem Interview spricht Sue Goyette konkret „die Stadt Halifax und deren Nähe zum wilden Ozean an. Dieser fungiere für Dinge, mit denen wir uns nicht beschäftigen wollen, bis wir dazu gezwungen werden.“1 In den Gedichten werden zwischen all den zauberhaften Elementen plötzlich Ideen zur weiteren Gestaltung von Halifax und Darthmouth eingeflochten. „Man plant Neubauten, die sich vom Ozean ab und der Sonne zuwenden, um endlich die Distanz zu wahren oder überlegt eine breitere Uferpromenade für Touristen anzulegen.“ (vgl. S.46/47). Die sprechende Gemeinschaft besteht aus einer Reihe wiederkehrender Protagonist*innen, wie den erwähnten Dichtern, aber auch Rettungsschwimmern, Barbieren oder Architekten. Sowie einzelnen Personen, deren Schicksal aufgezeichnet wird, wie jenes „der Frau, deren Sohn vor langer Zeit in einem gestohlenen Boot aufgebrochen war, um nie zurückzukehren.“ (S.68, Sechsunddreißig).
Ich habe mich beim ersten Lesen auf die Kraft des Ozeans konzentriert, um mich nicht einlullen zu lassen. Und der Sommersehnsucht nach einem kühlenden Gewässer zu entgehen. Dabei gibt es ein weiteres Element, das zum großen Reichtum dieser Lyrik beiträgt und das ist der unglaublich feine Humor, der in dem Band steckt. Denn der Ozean übertreibt gern. Er ist manchmal Diva, dann wieder Domina. Sein Verhältnis zum Mond ist wechselhaft und manchmal scheint er sich gar einfach mit Dichtung zu besänftigen lassen. Worte werden zu einem Lockmittel. Und jede Zeile macht ungewöhnliche Bilder auf, die im Kopf doch zu einer konkreten Handlung werden. Das Fortschreiben von Gedicht „Eins“ bis „Sechsundfünfzig“ ist eine Wellenfahrt, der man sich nicht entziehen kann. Und in meinem Fall auch nicht entziehen will. Für mich hat dieser Band Suchtpotenzial. Und die Übersetzung ist so großartig, dass sie sich nahtlos einfügt, wenn man Sue Goyette dann im Original lesen hört. Folgendes Video stammt von der Lesung beim renommierten „Griffin Poetry Prize 2014“ für den sie nominiert war. Die Lesung des Gedichts: „Forty-Eight“ gibt es bei Minute 1:55 nachzuhören: https://www.youtube.com/watch?v=hSA04dWLRqg. 2015 gewann Sue Goyette dann den „Lieutenant Governor of Nova Scotia Masterwork Arts“.
Der Tourismus war großartig, bis der Ozean plötzlich einen auf Kojote machte. Hinter den Schulhöfen lauern, Menschen angreifen. Uns wurde gesagt, wir müssten uns groß machen. Aggressiv auftreten. Experten für Animal Control sagten uns, wir hätten seinen natürlichen Lebensraum mit unseren motorisierten Händen und unserem fettigen Bürgermeister verschmutzt. Er müsse sich weiter weg ernähren und sei zu wild für eine Vermittlung“ (…) Sue Goyette: Ozean, Achtundvierzig, S. 40/41
So schwer es mir fällt, mich zu entscheiden, teile ich zum Abschluss doch eines meiner liebsten Gedichte des Bandes. Was mich daran beglückt, ist schwer zu definieren. Vielleicht sind es die Seelen, die eigentlich immateriell sind und wie der in Dosen gefangene Nebel an früherer Stelle zu etwas Konkretem werden. Vielleicht ist es die Stimmfärbung der Kinder, wie rosa Lämmer, die mich berührt. Ganz bestimmt ist es auch die Fluidität der Worte, der Metaphernreichtum, der immer punktgenau am Thema bleibt, denn selbst die Einsamkeit ist flüssig, wenngleich zäh wie Sirup.
ACHTUNDDREISSIG Seelen wurden zur perfekten Ablenkung. Wir mussten ihre Kleidung sauber halten. Wir mussten ihre Stimmung aufbessern. Doch einige von uns waren so verwundet, dass unsere Tage nicht ohne Krücken auskamen. Wir waren Invaliden in den fahlen Krankenhausstunden unserer Küchen. Niemand hatte uns gewarnt, dass unsere Kinder verschwinden würden und wir ihrer beraubt wären, wir hielten die Bettwäsche ihrer Kindheit hoch und atmeten die rosa Lämmer ihrer Stimme ein. Wir hatten keine andere Wahl, als den Dichtern die Falle mit den gezuckerten Wortködern zu entwenden und uns am Ozean zu treffen. Mutig versuchten wir, diese zu rezitieren, ohne dabei zu verzweifelt zu klingen. Dass unsere Seelen auf dem Hügel hinter uns grasten, spielte keine Rolle mehr. Wir wollten unsere wandernden Kinder nach Hause locken. Die Worte, die wir benutzten, trugen den dünnen Sirup unserer Einsamkeit auf den Adern. Auf diese Weise lernten wir, dass auch Worte Seelen haben, und als die Seelen unseren Worten entwichen gab es ein Glitzern, das den Ozean überzog, und für einen Augenblick hatten wir seine Gezeiten versüßt. Sue Goyette: Ozean, Sechsunddreißig, S. 70
1 https://poetryinvoice.ca/read/poets/sue-goyette

Sue Goyette: Ozean. Aus dem Englischen von Michael Stavarič und Romina Nikolić. Matthes & Seitz Berlin, 2024. 99 Seiten, Euro 20,-




