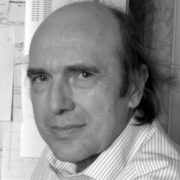Alexander Kluy liest Siljarosa Schletterers körperentschämungen
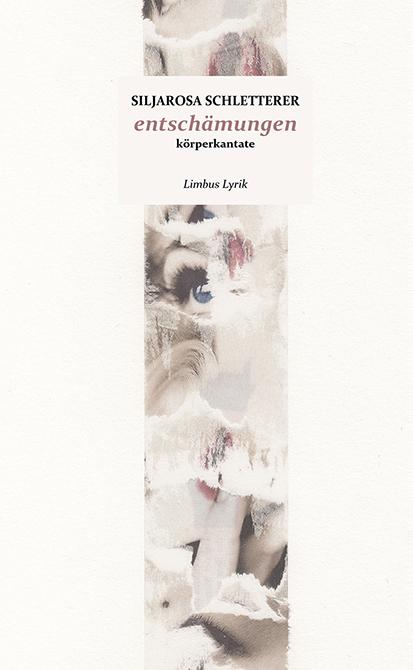
Unter die Haut gehen. In den Körper hineinkriechen. Das Biologische zu fassen versuchen. Der Scientific Turn des 21. Jahrhunderts hat vor den Feuilletons großer Tages- und Wochenzeitungen nicht Halt gemacht. Im Gegenteil. Einst strikt der Wissenschaftssektion vorbehaltene, trockene bis akademisch verstiegene Themen werden heute im Kulturteil diskutiert und ausgebreitet.
Cover © Limbus Verlag
Die Revolution des durch den US-amerikanischen Biochemiker Craig Venter entschlüsselten und sequenzierten menschlichen Genoms war einst einer großen konservativen Zeitung für Deutschland mehrere großformatige Feuilletonseiten wert, wobei der Unterhaltungswert sich jedoch deutlich im niederen Bereich bewegte.
Auch in den Arbeitszimmern von Dichterinnen und Autoren hielt der Biologismus novus, das Interesse für Naturwissenschaftliches, Einzug. So beschäftigte sich Hans Magnus Enzensberger mit Mathematik und Chaostheorie und schrieb über beides, Raoul Schrott sang in Erste Erde (2016) episch von DNA, Planeten, Kosmologischem und der deutsche Lyriker Durs Grünbein inkorporiert gern Erkenntnisse aus den scheinbar exakt beobachtenden Disziplinen in seine Texte.
Code und Sprache
Codierung und Entschlüsselung, das hat die Literatur schon immer gereizt. Erst recht, wenn es um den Körper gegangen ist, um Körperliches. Schreiben war ja sehr lange etwas Körperliches, etwas Körperunmittelbares. Man hielt ein Schreibinstrument in der Hand. Es war also haptisch; und es war akustisch. Denn man konnte, war man allein, den Federkiel, den Bleistift, den Kugelschreiber auf Papier sacht kratzen hören, kreierte man neue Sätze oder ein neues Sprach-Bild.
Eine neue Sprache finden, die ältere und alte ergänzt, das Physisch-Physiologische zum Thema wählen. Das ist in jüngster Zeit auch ein Trend im Buchhandel und Verlagswesen. So erschienen anno 2023/2024 in kurzem Abstand Porträt-Bände von Zunge, Brust, Penis und Podex. Der Londoner Wissenschaftshistoriker und Biologe Lewis Dartnell ging sogar so weit, sein neuestes Buch „Being Human“, Mensch sein, mit dem Untertitel „Wie unser Körper Weltgeschichte schrieb“ zu versehen.
Die mit Anfang 30 noch immer junge Tiroler Lyrikerin Siljarosa Schletterer will aber anderes. Sie will mehr. Es ist ein Kranz von Liebes-, besser: von Körper-Gedichten, die sie unter dem Titel entschämungen als – so die mitgegebene Genre-Bezeichnung – „körperkantate“ vorlegt.
Nachdem sie 2022 mit azur ton nähe. flussdiktate debütierte, geht es nun ganz konkret und blutig bei ihr um Flüsse, etwa um die Menstruation, aber auch um das blutende Herz. In zwei Sektionen plus einer Beigabe, einem online aktivierbaren Extra, erweitert sie das Sagbare um (fast) Unmögliches. Das scheint schon in der Dedikation auf, in der es um das „Hören“ des Körpers geht und ums Erheben der Stimme. Es geht ihr dort um
das sprechen
ent
kleiden
& hüllen
ins wahrspüren
In immer neuen Anläufen umkreist sie den „sehnsuchtsort körper“, und dies raffiniert. Denn diese Stelle in der „aria“, vierter Eintrag der ersten Sektion, die nach Prinzipien einer Choralkantate geordnet anmutet, liest sich tatsächlich so:
sehnsuchtsort körper
los
sing ich
aus den boxen
noch immer
Gekonnt, ja mit großer verspielter Anmut setzt Schletterer Verschleifungen ein, Verzerrungen, Enjambements und grammatikalische Widerhaken.
Natürlich geht es naheliegender Weise um Anatomie und Emotionen, um Körper konkret und Seele in metaphysicis, um Leiblichkeit und Außerdinglichkeit, um Verwundbarkeit und gesellschaftliche Verfügbarkeit, auch um Verfügbarmachung und um die Reduktion des Weiblichen auf rein Reproduktives. Es geht aber auch um Macht und Ermächtigung, um Lust und Obsession, um Schmerz, Pein und Erinnern. Wie um das ganz Andere:
wenn das leben platz für träume hat reichen sie vernarbt in die zukunft
Einige Male präsentiert sie dasselbe Gedicht in Hoch- und Schriftdeutsch und in Tiroler Mundart, was bei lautem Lesen gänzlich andere Hall-, Schall- und Spürräume zu erschließen vermag.
Teile und Atlas
In Teil II geht sie dann Anatomisches präzis wie poetisch verfremdend durch. Da liest man dann Gedichte über „os pubis“ und „tuba uterina“, „corpus sterni“ oder „glans clitoridis“, auch „regio inguinalis“ oder „fundus uteri“. Kein Beschreiben des (weiblichen) Körpers in (neun) Teilen ist das. Das exerzierte schon der postmoderne US-Autor Raymond Federman vor zwanzig Jahren in seinem verspielten Nicht-Autofiktions-Buch „Mein Körper in neun Teilen“ (dt. 2008) durch. Vielmehr ist es eine lyrisch-feministische Poetisierung der Physis in seiner Be- und Einschränkung und im gleichzeitigen Überwinden derselben. Dabei ist beim Immer-wieder-Lesen vor allem auf die Zunahme der Korrespondenzen zwischen Teil I und Teil II zu achten. Denn Querverbindungen stellen sich mehr und mehr, nach und nach ein.
Schletterer geht dabei nicht hermetisch vor, auch nicht surrealistisch verrätselnd. Ihre Bildsprache bleibt stets im Konkreten. An vielen Stellen realisiert man gekonnt sensible Zuspitzungen und mutmaßlich schwer erarbeitete Pointierungen. Sie arbeitet viel mit Worttrennungen, mit Wort-Sperrungen, mit Zeilenbrüchen. Dies ergibt schließlich einen „atlas / an spuren“, der vieles enthält, von Sanftheit bis Gewalt, von Wut über Stigmatisierung zu starken Bildfindungen, letztlich eine Arbeit im Bergwerk gesellschaftlich normierter Sexualmoral und peinlich beschwiegender Sexualität, aufgehoben, leicht gemacht als bemerkenswerte, ja als erstaunliche Poesie:
den gefühlen & entschämungen freien lauf lassen das mussten wir uns erst selbst erlauben
Siljarosa Schletterer: entschämungen. körperkantate. Mit drei Grafiken von Franz Wassermann. Limbus Verlag, Innsbruck und Wien, 2025. 96 Seiten. Euro 15,–