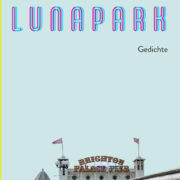Stefan Schmitzer liest Ich hab so Angst, daß die Chinesen kommen von Andreas Okopenko

Um die österreichische Lyrik zweifach verdient gemacht hat sich Daniel Wisser mit dieser Herausgeberschaft eines Auswahlbandes mit Gedichten von Andreas Okopenko. Dies erstens, weil es zehn Jahre nach dem Tod des Dichters seine einzelnen Gedichtbände der Fünfziger-Sechziger-Siebziger bloß noch in den Bibliotheken zu finden gibt – und Leuten, die diese dort gezielt zu suchen wissen, nicht zwingend auffällt, dass sie inzwischen vergriffen sind, während das jüngere Publikum nicht weiß, dass es was verpasst.
Wohl ist die Gesammelte Lyrik weiterhin lieferbar, von Okopenko selbst 1980 für Jugend&Volk zusammengestellt und heute im Vertrieb des Droschlverlags, aber die ist an der Entstehungszeit einzelner Gedichte orientiert. Der Dichter selbst sortiert seine Arbeiten dort in drei „Entwicklungsperioden“, ignoriert jedoch den ursprünglichen Publikationskontext der einzelnen Einträge – vom vormals Unveröffentlichten über den Gelegenheitstext zum zentralen Gedicht seines Originalbandes steht alles Mögliche nebeneinander, unausgewiesen auch im Inhaltsverzeichnis. Insofern ist jene „Gesammelte Lyrik“ als blankes Leseexemplar fein, sogar deutlich umfangreicher als Wissers neuer Band.
© Copyright Jung und Jung Verlag
Doch um sich einen Überblick darüber zu verschaffen, wer da, und in welchen Kontexten, geschrieben hat, ist die „Gesammelte Lyrik“ ungeeignet. Sie war ein historisches Lebenszeichen unter anderen Lebenszeichen Okopenkos und – zum Glück! – keine Selbsthistorisierung. Wenn also Wisser in seinem knappen Nachwort schreibt, seine Herausgabe solle
ein Wegweiser sein für all die, die nachlesen wollen
dann dürfen wir konstatieren: Dem Anspruch wird das Buch gerecht. Keineswegs ersetzt es die vollständige Neuauflage. Aber es beschildert die Leerstelle, die eine solche Neuauflage füllen würde, in Lage, Größe und Tiefe genau und übersichtlich: Gedichte aus Grüner November, Seltsame Tage, Warum sind die Latrinen so traurig?, Orte wechselnden Unbehagens und Der Akazienfresser sind repräsentiert, und das Nachwort erklärt auf sechs knappen Seiten übersichtlich, mit wem, und mit welcher sprachphilosophischen Einbettung man es zu tun hat. Ins Zentrum der Aufmerksamkeit stellt Wisser das Langgedicht „7. Mai“,
das ich für eines der bedeutendsten deutschsprachigen Gedichte des 20. Jahrhunderts halte, unter anderem deshalb, weil es das poetologische Koordinatensystem, in dem es sich bewegt und die Möglichkeit eines viel umfassenderen, ja potenziell endlosen Textes skizziert, aus sich heraus gewinnt.
Okopenkos „7. Mai“ ist eine potentiell endlosen Liste von Sachverhalten, die sich dem Blick über eine erstarrte soziale Wirklichkeit zeigen. Der Text lebt von der Spannung, dass wir lesend nicht wissen, ob sich die gezeigte Starre dem Blick, also dem Medium des Gedichts, also der Sprache verdankt – dann wäre alles, was wir sähen, ein unendlich tiefenscharfes, synchrones Panorama „in Bernstein“ – oder ob wir es mit einer „naturalistischeren“, sozusagen diachronen Schilderung einer wirklich versteinerten, erstarrten, dornröschenmäßig von Dornen überwucherten Welt zu tun haben. Schläft und träumt bloß die Sprache oder schläft und träumt die Welt selbst (und das hieße dann aber, dass die Sprache hellwach wäre). Es spricht einiges dafür, in diesem Gedicht einen der Momente zu sehen, wo die zwei genuin österreichischen Nachkriegsströmungen der Literatur – Sprachkritik bzw. -skepsis und Nähe zum Kabarett – in eins fallen.
Der zweite Grund, aus dem sich Wisser mit diesem Band sehr verdient gemacht hat, ist die Publikation von vier bisher gänzlich unveröffentlichten Gedichten,
die ich in Okopenkos Nachlass entdeckt habe
– unter ihnen der titelgebende Text „Ich hab so Angst, daß die Chinesen kommen“ (wir beachten die Entscheidung des Lektorats, die s/ss/ß-Schreibung auch des Buchtitels nicht der neuen Rechtschreibung anzupassen).
Drei dieser vier Texte – „Der Fernseher“, „Die Werbetexterin“ und „Der Computer“ – sind vage volksliedhafte Kabarettmoritaten (wir denken uns als Hallraum ungefähr die frühen Sendungen des Bronner’schen „Gugelhupfs“), die verschiedene für uns Heutige im Detail fast schon vorsintflutliche Ängste über Automatisierung und Planbarkeit in Industrie und Alltag behandeln (der 1979 geborene Rezensent wüsste ohne fremde Hilfe nicht einmal zu sagen, ob diese Gedichte einen Stand der Technik von anno ca. Kennedy oder anno ca. Reagan abbilden, anno Kreisky oder selbst noch anno Vranitzky). Die Komik dieser drei Texte resultiert nicht so sehr aus ihrer schein-biederen Anzüglichkeit – die erscheint uns eher als Zeitkolorit – sondern aus dem Wissen, dass technischer Fortschritt die gesellschaftlichen Gegensätze und Spannungen, auch innerhalb des Ich, erstmal nur verschärft; und dass die fortschrittsoptimistische Verbesserungshoffnungen zwar nicht notwendig falsch sind, aber völlig deplatziert, wenn sie sich bloß an die Technik heften.
Der vierte Text dieser Sammlung, eben „Ich hab so Angst, daß die Chinesen kommen“, teilt mit den anderen dreien Grundstimmung und Tonfall, eskaliert aber zu einer Satire über das faszinierte Starren über den „Eisernen Vorhang“ – eine Denunziation des schlecht verdrängten Wissens der Spießbürger*innen um 1970-80 um die historische Veränderlichkeit, ja dringende Veränderungsbedürftigkeit der eigenen Lebensumstände, in der Verdrängung geronnen zur angstlüsternen Strafphantasie davon, was geschehen kann oder gar soll, wenn der „Kalte Krieg“ endlich heiß würde (halt mit den „Chinesen“ statt den „Russen“ in der Rolle des wilden Barbarenvolkes aus der Steppe).
Alles in allem: Als Einstieg in Okopenkos Lyrik ist der Band, obzwar weniger umfangreich, besser geeignet als die Sammlung aus 1980, weil übersichtlicher; den Fortgeschrittenen bietet er immerhin die vier „ganz neue“ Gedichte. Da das liebste Okopenko-Gedicht des Rezensenten bei Wisser allerdings – herausgeberisch durchaus nachvollziehbare – eklatant unvertreten bleibt, sei es hier, einfach, um es in Umlauf zu halten, zum Abschluss zitiert:
Vorgang aus roter Tinte Rote Tinte wird in weißes Wasser geschüttet. Im Abendleuchten kehrt Odysseus nach Ithaka heim. In seinen Parks spielen die Kinder der Fremden. Er stellt eine Frage, die ihr verstehen sollt: Wo sind die Lichter des ausgebrannten Chicago? Er stellt die Frage sinnreich, bärtig und schwer. Über seinem Haar schwirren die Mücken des Waldrands. Die Linien, die die ziehn, leuchten wie Fenchel wenn Wind geht. Aus dem Wald schleppen Männer hölzerne Kübel mit Waldpech, Hinter dem Horizont geht ohne Ende ein Schiffshorn – – –
Andreas Okopenko: Ich hab so Angst, daß die Chinesen kommen. Ausgewählte Gedichte. Herausgegeben und mit einem Nachwort von Daniel Wisser. Jung und Jung, Salzburg 2020. 144 Seiten. Euro 20,-